Hallo lieber Besucher! Noch kein Account vorhanden? Jetzt registrieren! | Über Facebook anmelden

Hallo lieber Besucher! Noch kein Account vorhanden? Jetzt registrieren! | Über Facebook anmelden

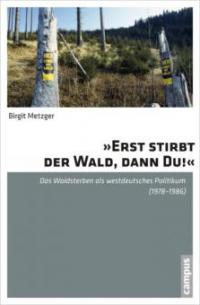
Einleitung "Hochschwarzwald, 15. September 2010: Der Revierförster, zwei Beamte des Bundesumweltministeriums, Bestandsaufnahme im Schadensgebiet 4, Sankt Blasien: Schadstufe 4, abgestorben." Zu sehen ist eine Fläche, die größtenteils mit Gräsern und einigen niedrigen Sträuchern bewachsen ist. Vereinzelt stehen Nadelbäume herum. Ihre Kronen sind schütter und licht, sie bestehen aus nur wenigen Zweigen und Nadeln. Auf dem Boden verstreut liegt trockenes Geäst. Langsam hebt sich die Kamera in einige Meter Höhe. Im Luftbild ist das große Ausmaß dieser steppenartigen Fläche zu erkennen. "Die Fakten: Im Schwarzwald, in den Alpen, im Bayerischen Wald, im Fichtelgebirge, im Odenwald - überall die gleichen Bilder: Schadstufe 3 - schwerkrank, Schadstufe 4 - tot. Oberhalb 600 Meter wird abgeholzt, zu retten ist da nichts mehr. Und je nach Lage: Endzustand auch in den Tälern." So beginnt die Doku-Fiktion Kahlschlag - Der Waldreport 2010 von Joachim Faulstich (Hessischer Rundfunk, 1989), in der mit damals neuester Bildbearbeitungstechnik eine ökologische Zukunftsvision des Jahres 2010 entworfen und mit dem Zustand von 1989 verglichen wird. Die Bilder bringen eine pessimistische Zukunftserwartung zum Ausdruck: Die Wälder in den westdeutschen Mittelgebirgen würden 2010 weitgehend abgestorben sein, Bauernhöfe verlassen, Erdrutsche und Lawinen würden folgen. Wiederaufforstung wäre ein äußerst schwieriges Unterfangen, weil die Böden so stark versauert wären, dass junge Bäume kaum wachsen könnten. Dieses Katastrophenszenario stellte den Kern der Waldsterbensdebatte der 1980er Jahre dar. Demzufolge drohte der Wald innerhalb weniger Jahre komplett abzusterben, sofern nicht die den Sauren Regen verursachenden Abgase aus Industrie, Kraftwerken und Verkehr maßgeblich reduziert würden. Diese Warnung äußerten Forstwissenschaftler erstmals um 1980 und lösten damit eine der größten und intensivsten Umweltdebatten der deutschen Geschichte aus. In kurzer Zeit avancierte das Waldsterben zum "Umweltproblem Nr. 1": Es war zwischen 1981 und 1986 in Presse und Rundfunk omnipräsent, wurde zum Gegenstand von massenhaft publizierten populärwissenschaftlichen Schriften, von Wahlkämpfen und spek-takulären Protestaktionen. Zwar hatte eine breitere umweltpolitische Aktivierung in der Bundesrepublik spätestens in den 1970er Jahren eingesetzt. Aber anders als etwa die Diskussionen um die Nutzung der Atomenergie oder die Auswirkungen der chemischen Industrie in den 1970er Jahren, die äußerst kontrovers verliefen, die die Gesellschaft in Befürworter und Gegner spalteten und die teils gewalttätig ausgetragen wurden, bot das Waldsterben quer durch soziale Milieus und politische Lager vielfältige Anknüpfungspunkte. Führende Wissenschaftler, Forstleute, linke Umwelt- und konservative Naturschützer sorgten sich Anfang der 1980er Jahre ebenso um den Fortbestand des Waldes wie Bundeskanzler Helmut Kohl und die erste grüne Bundestagsfraktion. Dabei befürchteten viele Bundesbürger nicht nur das großflächige Absterben des Waldes, sondern betrachteten es als Ausdruck einer umfassenden Umweltkrise, die in ihrer Konsequenz auch die menschliche Existenz bedrohte. "Erst stirbt der Wald, dann der Mensch" war ein verbreitetes Schlagwort in den 1980er Jahren, das diese Besorgnis ausdrückte. Auch von einem "ökologischen Hiroshima", ja einem "ökologischen Holocaust" war die Rede. Dieser emotional und moralisch aufgeladene Katastrophendiskurs setzte gesellschaftlich und politisch viel in Gang: Die seit Oktober 1982 amtierende Bundesregierung, eine Koalition von CDU/CSU und FDP, verabschiedete unter dem großen Druck der Öffentlichkeit ein um-fangreiches "Aktionsprogramm" zur Rettung des Waldes. Als wirkungsvoll und wegweisend erwiesen sich die in dieser Zeit eingeleiteten nationalen und europäischen Regelungen zur Verminderung der Luftverschmutzung. Aber auch die großzügige Förderung der forstwissenschaftlichen Forschung oder die regelmäßige und systematische Beobachtung des Waldzustandes gehörten zu den folgenreichen Maßnahmen, die zunächst aufgrund des angenommenen Waldsterbens ergriffen wurden. Im Jahr 2014, rund 30 Jahre nach den eindringlichen Warnungen vor dem baldigen Tod des Waldes, steht und wächst der Wald in Deutschland und in Europa noch immer. Anders als in der Doku-Fiktion Kahlschlag befürchtet, hat die mit Wald bewachsene Fläche in der Bundesrepublik in den letzten Jahren sogar leicht zugenommen. Vom Waldsterben als einem akuten Umweltproblem ist kaum noch die Rede. Gegenstände der Umweltdebatte sind stattdessen der globale Klimawandel und Katastrophenereignisse wie in den letzten Jahren die Explosionen im Atomkraftwerk von Fukushima im Frühjahr 2011 oder die Havarie der Öl-Bohrinsel Deepwater Horizon vor der amerikanischen Küste im Jahr 2010. Offensichtlich ist die Prognose eines großflächigen Waldsterbens nicht eingetreten. War also das Waldsterben ein "Öko-Irrtum", eine irrationale Panikmache und Medienhysterie? Oder handelte es sich um eine Erfolgs-geschichte des Umweltschutzes, in der es gelang, ein drängendes Umwelt-problem erst groß öffentlich zu thematisieren und dann Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die bevorstehende Katastrophe im letzten Moment abgewendet werden konnte? Gegenwärtige Erklärungen und Bewertungen der Waldsterbensdebatte fallen höchst unterschiedlich und teils widersprüchlich aus. Allein die Tatsache, dass das Katastrophenszenario nicht Wirklichkeit geworden ist, reicht nicht zur Klärung der Fragen aus, die das Waldsterben und die darüber geführte Debatte auch heute noch aufwerfen. Deutungstendenzen und Erklärungsansätze des Waldsterbens In der wissenschaftlichen Literatur werden das Waldsterben und die dar-über geführte Debatte sehr unterschiedlich interpretiert. In der Forstwis-senschaft hat sich im Lauf der 1990er Jahre zunehmend die Einschätzung durchgesetzt, dass von einem stattfindenden oder unmittelbar bevorste-henden großflächigen Waldsterben nicht die Rede sein könne. Umstritten ist allerdings, wie die damals beobachteten Phänomene im Wald konkret einzuordnen und zu bewerten sind. So vertreten viele Forstwissenschaftler die Position, dass die Wälder in den 1980er Jahren stark unter Luftschadstoffen litten und auch heute noch leiden. Einige meinen sogar, die Waldsterben-Prognosen hätten sich ohne die drastische Reduktion der Luftschadstoffemissionen tatsächlich erfüllt. Andere bezweifeln, dass die Diagnose eines großflächigen Waldsterbens überhaupt je berechtigt war und gehen davon aus, dass selbst im Falle eines worst case schlimmstenfalls regional begrenzt Waldbäume abgestorben wären. Hinzu kommt die bis heute umstrittene Ursachenfrage: Bereits in den 1990er Jahren sahen zahlreiche Forstwissenschaftler keinen oder lediglich geringen Einfluss von anthropogenen Luftverunreinigungen auf den Zustand der Wälder. Die in den 1980er Jahren beobachteten Waldschäden seien stattdessen durch Trockenjahre und Frostereignisse zu erklären. Einzelne Wissenschaftler befürchten wiederum, dass die wirklich großen Schäden noch bevorstehen, sei es aufgrund der weiterhin großen Mengen an Stickstoffimmissionen oder aufgrund des Klimawandels. Diesen divergierenden naturwissenschaftlichen Einschätzungen der Waldschäden entsprechen in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Li-teratur zwei Interpretationsansätze. Auf der einen Seite wird die Wald-sterbensdebatte als unmittelbare gesellschaftliche Reaktion auf ein Phäno-men in der natürlichen Umwelt verstanden. Mehr oder weniger stark for-muliert liegt dieser Problem-Reaktions-Ansatz einer Reihe von politikwis-senschaftlichen Studien vor allem aus den 1980er und 1990er Jahren zu-grunde, die sich mit der staatlichen Umweltpolitik in Reaktion auf das Waldsterben befassen. Dabei ist häufig die Kategorie des Erfolgs zentral. Viele Autoren kommen mit Blick auf das Waldsterben zu dem Ergebnis, dass die 1980er Jahre als Phase einer aktiven und erfolgreichen Umweltpolitik gelten können. Denn in dieser Zeit seien wirksame Maßnahmen zur Verminderung der Luftverschmutzung ergriffen worden. Vereinzelt wurde die sogenannte Problemdruckthese auch in den letzten Jahren noch vertreten. So führt etwa der Historiker Andreas Wirsching den gesamtgesellschaftlichen Konsens über das Waldsterben in seiner Geschichte der Bundesrepublik der 1980er Jahre auf die objektive Dringlichkeit des Problems zurück: "Die objektivierbaren Schäden [waren] viel zu offenkundig und gravierend, als dass sie nicht die Sorge der Bevölkerung sowie der politischen Akteure erregen mussten." Mit Verweis auf die Waldschadensberichte nimmt Wirsching die Waldschäden als Sachverhalt an, der zwangsläufig zu politischen Reaktionen führte. Auf der anderen Seite wird in der neueren umweltsoziologischen Lite-ratur die Tatsache, dass die prognostizierte Katastrophe ausgeblieben ist, und dass nach wie vor naturwissenschaftliche Ungewissheiten über das Phänomen herrschen, als Anlass genommen, um das Waldsterben kritisch unter die Lupe zu nehmen und als Umweltproblem zu dekonstruieren. Das Waldsterben und die Debatte darüber gelten inzwischen als prominentes Beispiel dafür, dass die gesellschaftliche und politische Behandlung von Umweltproblemen nicht einfach als sozialer Niederschlag eines objektiven Problemdrucks zu verstehen ist, sondern dass diese immer sozial und kulturell vermittelt werden. Gestützt wird dieser Ansatz durch das Argument, dass das Waldsterben in benachbarten Ländern wie der Bundesrepublik und Frankreich ganz unterschiedlich debattiert worden sei, obwohl sich die beobachteten Phänomene ähnelten. Erste geschichtswissenschaftliche Betrachtungen haben zur Dekonstruktion des Waldsterbens zwei weitere Argumente hinzugefügt. Zum einen war das Phänomen der Waldschäden in den 1980er Jahren nicht neu. Vielmehr waren immissionsbedingte Waldschäden spätestens seit dem 19. Jahrhundert unter dem Begriff "Rauchschäden" bekannt und wurden wissenschaftlich erforscht. Folglich war in den 1980er Jahren vor allem die große öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Phänomen neu. Zum anderen lässt sich das Waldsterben als Ausdruck einer verbreiteten Krisenstimmung und Fortschrittsskepsis verstehen, die die westdeutsche Gesellschaft zu Beginn der 1980er Jahre ergriffen hatte und bei der die in dieser Zeit starken Protestbewegungen eine besondere Rolle spielten.