Hallo lieber Besucher! Noch kein Account vorhanden? Jetzt registrieren! | Über Facebook anmelden

Hallo lieber Besucher! Noch kein Account vorhanden? Jetzt registrieren! | Über Facebook anmelden

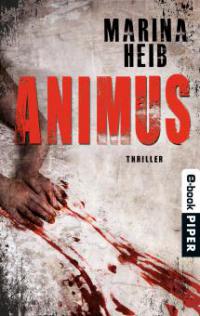
ERSTER TEIL 1. Prolog Professor Irvin Schmelzer, 64, Biochemiker und Molekularbiologe Mein richtiger Vorname ist Erwin. Ich bin Deutscher. Weil in den USA niemand den Namen Erwin richtig aussprechen kann, habe ich mich in vorauseilendem Gehorsam Irvin genannt. Dabei spricht mich hier niemand mit meinem Vornamen an. Alle sagen Professor. Oder sie sagen ´Arschloch`. Wer recht hat, ist mir schon lange egal. Und wer mich richten wird, auch. Ich habe das alles hier nicht zusammengestellt, weil ich mich rechtfertigen will. Oder gar reinwaschen. Weder mich noch irgendeinen anderen. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe gemacht habe. Ich habe Tagebuchseiten kopiert. Illegal Teile von Vernehmungsprotokollen besorgt. Ich habe meine besten, meine einzigen Freunde gequält, sich zu erinnern. An etwas, das sie vergessen wollen. Ich bat sie, möglichst exakt aufzuschreiben oder auf Band zu sprechen, was wann warum geschehen ist. Wer was wann gefühlt hat. Sie haben es getan. Vielleicht wollte ich das alles zusammenfügen, um es endgültig loszuwerden. Es sollte aus mir heraus. Weg von mir. Auf neutrales, stummes Papier. Es ist schwierig, einen Zeitpunkt festzulegen, an dem es begann. Als Wissenschaftler wäre ich geneigt zu sagen: mit dem Urknall. Mit der ersten Kaulquappe, die an Land kroch. Mit dem aufrechten Gang. Dem Menschen. Seiner Arroganz. Seiner mangelnden Ehrfurcht vor der Schöpfung. Aber es geht nicht um den Anfang. Es geht um den Anfang vom Ende. Ich hatte mit meiner Arbeit gewaltsam ein Loch ins Gewebe der Zeit gerissen, um mich voreilig der Zukunft zu bemächtigen. Meine Strafe steht noch aus. Geblutet haben bislang andere. Ich sollte zunächst von dem Tag Ende August erzählen, an dem die Sitzung stattfand. Ich war auf dem Sofa in meinem Büro eingeschlafen, inmitten all der Unterlagen, die ich vorbereitet hatte, um in der Sitzung das zu verhindern, was ich unheilvoll am Horizont aufziehen sah. Meine innere Aufruhr wegen der Zeichen drohenden Unheils und das Wissen um meine Hilflosigkeit hatten dazu geführt, dass ich mich vom Schlaf übermannen ließ. Doch dort, in der Schwärze meines Unterbewusstseins, begegnete ich ihnen wieder. Unausweichlich. Den Schreien. Schüssen. Leichen. Dem Grauen. Der Schuld. Das Blut ist schwarz. Die Gesichter leichenblass. Die leblose Frauenhand, die auf dem entblößten Leib in ihrem eigenen Blut ruht, lilienweiß. Ich erwachte schweißgebadet. Ich zitterte. Das ist häufig so, wenn ich erwache. Damit muss ich leben – auch damit. Im Schlaf ist man schutzlos ausgeliefert. Den Träumen. Den dunklen Kellerlöchern der Seele. Den Orten, die auf keiner Karte verzeichnet sind. Die wahren Orte sind das nie, schrieb einst Herman Melville. Um vor der Wahrheit in die Wirklichkeit zu flüchten, schaltete ich den Fernseher ein. Es war früher Nachmittag, ein heißer Augusttag in Washington, D.C. Eine schauerlich schönheitsoperierte Frau begrüßte mit ihrem Kollegen die Zuschauer zu einer Nachrichtensendung, während ich meine Unterlagen zusammensammelte. »Guten Abend, meine Damen und Herren, hier auf Ihrem Kanal WCRK. Ich begrüße meinen Kollegen John. Hallo, John, wie geht es dir heute, deine Krawatte ist sehr kleidsam. Ich bin Marilyn, Ihre ganz persönliche Breaking-News-Show-Moderatorin von WCRK. Abgesehen vom nachfolgenden Wetterreport gibt es heute wenig Erfreuliches zu berichten, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen, nicht wahr, John?« »Nein, Marilyn, niemals, auch wenn wieder diverse obskure Gruppierungen an unserer Demokratie zu rütteln suchen. Und gerüttelt haben sie heute kräftig – in weiten Teilen des Landes. Bringen wir es hinter uns, Marilyn.« »Ja, John. Der schlimmste Anschlag der letzten beiden Wochen erschütterte heute New York, wo eine Explosion in der U-Bahn in Brooklyn 374 Todesopfer forderte. Bekannt zu dem Anschlag haben sich per Internet die Stadtguerillas ...« 2. Sondersitzung Pete, 36, Geheimagent Mein Büro besitzt eine Grundfläche von vier mal fünf Metern, ist weiß getüncht und zweckmäßig mit allen erforderlichen technischen Geräten, aber ohne ersichtlichen Komfort ausgestattet. Vom Fenster sieht man in einen unbelebten Innenhof. Das Fensterglas ist kugelsicher. Der Raum ist voll klimatisiert. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Es gibt keinen direkten Weg hinaus ins Freie. Man muss Umwege gehen. An dem Tag der Sitzung hatte ich wie immer den Fernseher laufen. Wie immer wurden die Werbeblöcke von Horrormeldungen unterbrochen. Ich packte unterdessen meine Unterlagen für die Sitzung zusammen und hörte nur mit einem Ohr hin. » ... auch dass die Ordnungskräfte trotz unermüdlichen Einsatzes keine verwertbaren Spuren finden konnten, gehört bedauerlicherweise zu unseren Standardmeldungen. In Los Angeles sieht die Bilanz des heutigen Tages – nur Zyniker reden vom Body Count – etwas besser aus: Bei den Gang Wars sind nur drei Tote zu vermelden. Besorgniserregend finden die Stadtväter von Los Angeles allerdings, dass sich das Krebsgeschwür Inglewood wie eine Wanderdüne ausdehnt. Damit steigt auch täglich die Kriminalitätsrate in den angrenzenden Gebieten. Auf der positiven Seite bleibt zu verbuchen, dass der Attentäter, dessen Anschlag auf den Bürgermeister von Los Angeles letzte Woche vereitelt werden konnte, gefasst und von einem Schnellgericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Was hast du denn noch zu melden, Marilyn?« »Oh, jede Menge, John, haha, das wirst du sehen, wenn wir heute Abend zu Hause sind. Aber Scherz beiseite, es geht dramatisch weiter: In Wisconsin wurde eine Zugbrücke in die Luft gesprengt, wobei zwölf Menschen ihr Leben ließen. In diesem Fall liegt noch kein Bekennerschreiben vor. In Insiderkreisen wird jedoch spekuliert, dass es sich bei der Tat um das empörende Gebaren gesellschaftsfeindlicher Jugendlicher handelt. Die wenig professionelle Ausführung des Anschlags deutet nach Aussage der Sachverständigen vor Ort darauf hin. Wohin, John, wird das alles noch führen?« »Der immense Anstieg terroristischer Übergriffe ist höchst besorgniserregend. Aber unsere Regierung steht wie ein Mann gegen diese Bedrohungen. Pamela Mitchum, die WCRK Korrespondentin in Washington, kann aus erster Quelle versichern, dass der Präsident plant, innerhalb kürzester Frist einen neuen Maßnahmenkatalog gegen die terroristischen Gruppen erstellen zu lassen, dem es weder an Härte noch an Durchschlagskraft mangeln wird. Bleiben Sie dran, nach der Werbung gehts weiter.« Ich schaltete den Bildschirm aus, nahm meine Beine vom Bürotisch und erhob mich aus meinem Ledersessel. Mir blieben noch zehn Minuten. Dann musste ich mit meinem Dienstwagen die kurze Strecke rüber zum Weißen Haus fahren, um an der Konferenz zum Projekt ´Cassandra` teilzunehmen. Zeit für eine Zigarette. Ich ging zum Bücherregal, griff hinter meine antiquierten Lexika, nahm eine Kippe und das Feuerzeug aus der dort versteckten Schachtel, schloss die Tür ab und schaltete die Klimaanlage höher. Ich fand es zwar unwürdig, mich zum Rauchen im Büro einzuschließen wie zu unmündigen Teenagerzeiten in der Schultoilette, aber noch mehr nervte mich, wenn einer meiner Kollegen plötzlich hereinplatzte und mich mit hochgezogenen Augenbrauen und missbilligendem Blick zum zigtausendsten Mal an das allgemeine Rauchverbot erinnerte. Ich zündete die Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. Obwohl mir das Heikle meiner Mission durchaus bewusst war, freute ich mich auf das Treffen. Die üblichen Streitigkeiten zwischen Professor Schmelzer und General Walcott würden mich amüsieren. Mir machte es Spaß zu beobachten, wie die Gegner mit ungleichen Waffen aufeinander losgingen: Schmelzer attackierte eloquent und spöttisch und nutzte dafür die Beweglichkeit seines Intellekts, während Walcott, der hochdekorierte Kommisskopp, seinen Willen mit Vorschriften, tumben Drohungen und wüsten Beschimpfungen durchzusetzen suchte – eine primitive Art des verbalen Scharmützels, die beim Professor stets ins Leere stieß. Beeindruckend fand ich, wie Frederic March die beiden ihm untergebenen Kontrahenten stets kurz und knapp in ihre Schranken verwies. March empfand bei der Beobachtung der Territorialkämpfe zwischen Schmelzer und dem General im Gegensatz zu mir offensichtlich keinen, nicht einmal heimlichen Genuss. Als Stabschef und Sicherheitsberater des Präsidenten mit dem dazu passenden zweckorientierten Charakter war er an Ergebnissen interessiert und zeigte keinerlei Sinn für menschlichen Zeitvertreib wie Hohn oder Zynismus. Dass March trotz seiner kühlen Ausstrahlung, die durch die eisblauen Augen und das chemisch gebleichte Haar noch unterstrichen wurde, auf mich nicht unsympathisch wirkte, konnte nur an seiner Direktheit und der unprätentiösen Souveränität liegen, mit der er jede Situation in den Griff bekam. Ich drückte meine Zigarette aus, ließ den Aschenbecher samt Inhalt provokativ mitten auf dem Schreibtisch stehen, schnappte mein zerknittertes Sakko vom Haken, die Tasche vom Boden, schloss die Tür auf und ging hinaus. Die Tür ließ ich in einer plötzlichen Anwandlung von alberner Anarchie weit geöffnet. Damit die Kollegen während meiner Abwesenheit auf dem Flur etwas zum Naserümpfen und Augenbrauenhochziehen hatten. Als ich nach nervenzerrüttenden zehn Minuten durch den Großstadtverkehr in Marchs Büro im Westflügel des Weißen Hauses ankam, saß Schmelzer schon am Konferenztisch und blätterte geschäftig in vollgekritzelten Unterlagen. Schmelzer entspricht meiner Meinung nach perfekt dem von einem berühmten Albert-Einstein-Foto geprägten Klischee des genialen, aber zerstreuten Wissenschaftlers: Er ist klein, etwas über sechzig Jahre alt, mit wildem weißen Haarkranz, sehr schlank und drahtig, mit hellwachen, gelegentlich vor Wut oder auch Begeisterung blitzenden grünen Augen. Auf dem Gebiet der Biochemie gilt Schmelzer als weltweite Autorität, doch vertieft er sich nie so sehr in den mikrokosmischen Inhalt seiner Reagenzgläser, dass er darüber den Blick für die Feinstofflichkeit zwischenmenschlicher Beziehungen verliert. Der deutsche Wissenschaftler zeichnet sich durch eine gewisse Verschmitztheit aus, die ihn mir richtig ans Herz hat wachsen lassen. Dass der mal kindlich-naive, mal bissige Humor Schmelzers dann und wann von einem Schatten stiller Deprimiertheit verdüstert wird, mag wohl an seiner speziellen Aufgabe liegen, derentwegen wir uns nun versammeln würden. Doch diese emotionale Bandbreite stärkte mein Vertrauen in den geistigen Vater unseres Geheimprojektes nur noch mehr. Ich mochte ihn schon immer. Und ich glaube, Schmelzer mochte mich auch. Ich hatte schon des Öfteren nicht ganz erfolglos versucht, ihm seine Aufgabe zu erleichtern, indem ich ihm gegen den General zur Seite stand. Wir begrüßten uns mit festem Händedruck. »Guten Tag, die Herren«, ertönte die brüchige Fistelstimme des Generals, die in krassem Gegensatz zu seinem klobigen Äußeren stand. Wir wandten uns um und nickten dem Eintretenden höflich, aber kühl zu. Ich setzte mich in deutlicher Allianz mit dem Professor auf die eine Seite des Tisches, der General in Feldherrenmanier ans Kopfende. Schmelzer blätterte ignorant in seinen Unterlagen, der General und ich blickten uns schweigend an. Mir war der General körperlich zuwider. Er legte mit seinen Fingern die Tischplatte unter ein Trommelfeuer und brach schließlich die Stille: »March kommt zu spät. Als wäre er der Einzige, der noch mehr zu tun hat. Was solls. Schönes Wetter heute, nicht wahr?« Diese hochmütig dahingeworfene Floskel war seine uninspirierte Art, Schmelzers und mein Desinteresse an seinem Eintreffen mit einer belanglosen Leerformel zu entlarven und gleichzeitig die Möglichkeit eines harmlosen Gesprächsangebots offenzulassen. Schmelzer stieg nur halbherzig darauf ein. »Finden Sie?«, bemerkte er betont gelangweilt, ohne den Kopf zu heben, und las demonstrativ weiter. Die Finger des Generals hörten auf zu trommeln, und seine Hand ballte sich unwillkürlich zur Faust. In diesem Moment trat March ein. Ich konnte beobachten, wie sich Walcotts Faust wieder entspannte und öffnete, um ihn zu begrüßen. March gab uns allen die Hand, setzte sich ans andere Kopfende des Tisches und eröffnete das Gespräch: »Lassen Sie uns gleich zur Sache kommen, meine Herren. Pete, Sie wissen, worum es geht.« Damit wandte er sich zu mir. Ich nickte und stellte mit Genugtuung fest, nach einem kurzen Blick aus den Augenwinkeln, dass der General sich durch diese Eröffnung sogleich übergangen fühlte. »General Walcott, Professor Schmelzer, ich möchte Sie über die neuesten Pläne und Ihre diesbezüglichen Aufgaben informieren. Wie Sie wissen, ist uns ein wichtiger Sensor in Los Angeles ausgefallen. Also haben wir hier in Washington die beiden Zehner, in San Francisco eine Acht und ansonsten nur noch zwei Siebener in Aktion, wenn man von den noch nicht aktiven Sechsern und den niedrigeren Stufen absieht. Ich möchte den Verlust jetzt nicht kommentieren, sondern Ihnen mitteilen, dass beschlossen worden ist, neue Sensoren zu rekrutieren, und zwar diesmal in größerem Maßstab, um weiteren Ausfällen vorzubeugen. Unser Freund vom Secret Service«, und damit nickte er wiederum in meine Richtung, »hat geeignete Kandidatinnen vorsortiert, aus denen wir gemeinsam mit Professor Schmelzer acht bis zehn auswählen werden. Gibt es dazu etwas zu sagen?« March blickte abweisend in die Runde, um klarzumachen, dass diese Frage rein rhetorisch gemeint war. Er wollte gerade fortfahren, als gleichzeitig Schmelzer und Walcott zu sprechen begannen. March hob abwehrend die Hände und erteilte Schmelzer das Wort. »Ich möchte an dieser Stelle zum wiederholten Male betonen, dass ich strikt gegen eine Erweiterung von Cassandra bin. Bislang war ich der Überzeugung, dass dieses Thema ein für alle Mal vom Tisch wäre. Ich betrachte das Projekt als gescheitert, und zwar weniger aus wissenschaftlichen als vielmehr aus humanistischen Gründen. Wie ich nach den Ereignissen vor vier Jahren schon konstatierte –« »Sie können konstatieren, so viel Sie wollen, lieber Professor«, fuhr der General schneidend dazwischen, woraufhin ich mich mit verschränkten Armen in meinem Stuhl ein Stück tiefer rutschen ließ. Ich wollte die sich ankündigende Vorstellung in möglichst bequemer Haltung verfolgen. »Ihre humanistischen Gesichtspunkte sind völlig fehl am Platz«, sagte Walcott mit seiner Fistelstimme. »Schließlich haben wir es nicht mit pickeligen Teenagern zu tun, die wir vor dem Bösen in der Welt beschützen müssen. Wir reden hier von Ratten, von beschissenen Weibern, die wir aus dem Knast geholt haben, damit sie unserem Staat zu irgendetwas nützlich sind, bevor sie abkratzen. Da diese Anforderung erfüllt wird, ist das Projekt keineswegs als gescheitert zu betrachten. Ich weiß, Herr Professor, dass Ihnen meine Ausdrucksweise zu rüde und ungebildet ist. Aber ich sehe die Dinge, wie sie sind, und nenne sie beim Namen, statt mir die Realität mit schöngeistigen Ideologien aus vergangenen Jahrhunderten vom Leibe zu halten.« »Hört, hört«, meinte Schmelzer spöttisch. Mit festem Blick hinderte er March am Eingreifen. »In der Tat, mein Lieber, passt mir Ihre Ausdrucksweise ganz und gar nicht. Außerdem liegt es mir am Herzen zu betonen, dass ich den aktuellen Verlust, wie Sie, Mister March, es zu nennen belieben, ebenfalls nicht stillschweigend akzeptieren kann. Man lässt mich zwar im Dunkeln über die genauen Vorgänge – ich vermute aus Rücksicht auf meine schon erwähnte zartfühlende Seele –, dennoch ist mir zu Ohren gekommen, dass das Dahinscheiden unserer Neun keineswegs auf biochemischen Komplikationen oder gar natürlichen Ursachen beruhte. Ich bin vielmehr überzeugt, dass der General seine Finger im Spiel hatte. Ein Spiel, das er auf pervertierte Art und Weise mit ´Eliminieren eines Sicherheitsrisikos` umschreibt. Ich nenne es Mord!« Beim letzten Satz schlug Schmelzer derart fest mit der flachen Hand auf den Tisch, dass sogar der beherrschte March zusammenzuckte. Ich fand, dass es Zeit war einzugreifen. Der General war vor Wut rot angelaufen, während Schmelzer am ganzen Körper zitterte und eher bleich aussah. Doch bevor ich etwas sagen konnte, hatte March sich eingeschaltet: »Meine Herren, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihre Grundsatzstreitigkeiten unterlassen könnten. Zumindest bis ich wieder aus dem Raum bin. Seien Sie versichert, Professor Schmelzer, dass es keine andere Lösung gab, sonst hätte ich sie gewiss favorisiert. Von Mord wollen wir nicht reden, das trifft nicht den Kern der Dinge. Aber wie dem auch sei, diese Vorkommnisse sind ein weiterer Grund, neue Sensoren – das ist mir immer noch lieber als ´Ratten` – zu rekrutieren. Nur durch intensivere Ausbildung und genauere Beobachtung in den ersten Jahren lassen sich Unwägbarkeiten im Verhalten der Frauen ausschließen. Ich hoffe, wir sind uns wenigstens in diesem Punkt einig. Außerdem reicht unser Kontingent, vor allem in Anbetracht der ansteigenden terroristischen Aktivitäten, schlichtweg nicht mehr aus. Wir müssen flächendeckend arbeiten. Angestrebt ist, in jeder Großstadt einen Sensor höheren Ranges zu haben, der dann auch für die Umgebung des städtischen Gebiets zuständig ist. Außerdem brauchen wir dringend einen Sensor höheren Ranges in New York, da sich die Stadtguerillas offensichtlich dort ihr neues Hauptquartier einzurichten gedenken. Wir planen, vorerst die Acht aus San Francisco abzuziehen. Die ganze Angelegenheit ist jedenfalls mit erheblichem Aufwand und zeitraubenden Vorbereitungen verbunden. Es wird Jahre dauern, bis wir unser Ziel erreicht haben. Für diese Planung sind wir hier. Eine Frage an Sie, Professor: Ist es tatsächlich unmöglich, das Hormon in höherer Dosis zu verabreichen oder in kürzeren Intervallen? Wenn man da etwas optimieren könnte, hätten wir eine Menge Zeit gespart.« Schmelzer saß, schockiert über die unabänderliche Erweiterung des Projekts und Marchs darüber hinausgehenden Forderungen nach einer Beschleunigung, in sich zusammengesunken da. Er schüttelte den Kopf. »Die Gefahren sind Ihnen bekannt. Wir können froh sein, dass die Nebenwirkungen inzwischen so weit eingegrenzt sind, dass wir zuverlässig arbeiten können. Zuverlässigkeit ist schließlich das A und O in dieser Geschichte. Was nützt es, wenn die Frauen zwar früher alarmieren, ihr Urteil aber ohne Gewähr ist? Man könnte vielleicht um ein Jahr verkürzen, vielleicht eineinhalb, aber mehr nicht, und das auch nur mit einem hohen Risiko.« Schmelzers Stimme wurde immer leiser. Man gewann den Eindruck, dass er nur noch mit sich selbst redete. Er stierte geistesabwesend auf die Unterlagen auf dem Tisch, ohne sie wirklich zu sehen. »Mal ganz abgesehen von den sicherlich lösbaren wissenschaftlichen Problemen«, hob Walcott mit einem zufriedenen Seitenblick auf den außer Gefecht gesetzten Professor an, »gibt es auch organisatorische Fragen zu klären. Wir müssen das Ausbildungslager ausbauen, mehr Personal zur medizinischen und materiellen Versorgung und vor allem auch zur Bewachung einstellen. Ein wichtiger Punkt für mich, denn zu dem Ausfall der Neun in Los Angeles ist es nur gekommen, weil wir auf Professor Schmelzers Anraten hin die permanente Beobachtung ab Stufe Sieben aufgehoben haben. Die Frauen, die von meinen Männern observiert werden, tanzen nicht aus der Reihe. Deshalb beantrage ich, dass die Verfügung, Ratten ab Stufe Sieben freizustellen, wieder aufgehoben wird.« »Wie können Sie es wagen!« Schmelzers Kampfgeist flammte sofort wieder auf, seine Augen sprühten Feuer. March ging dazwischen: »Ich kann Ihre Bedenken, was die Bewachung betrifft, nachvollziehen, General Walcott. Aber die bedauerlichen Ereignisse vor vier Jahren haben hinlänglich bewiesen, dass Professor Schmelzer richtiglag mit seiner Empfehlung, den Frauen ein möglichst normales Leben zu gestatten. Die permanente Bewachung stellt ganz offensichtlich einen so großen sozialen Stress dar, dass die für ihren Job erforderliche Sensibilität sich nicht entfalten kann, auch wenn man ihnen noch so viel C15 verabreicht. Deshalb werden wir diese Diskussion gar nicht erst wieder aufgreifen, und ich lehne Ihren diesbezüglichen Antrag ab. Was den Ausbau des Lagers und die Personalaufstockung betrifft, haben Sie jedoch meine volle Unterstützung. Lassen Sie eine Bedarfsliste anfertigen, ich werde alles Weitere veranlassen. Doch jetzt wollen wir Pete nicht länger langweilen, schließlich ist er hier, um uns neue Rekruten vorzustellen. Was haben Ihre Recherchen ergeben, Pete?« Ich nahm meine Akten aus der Tasche und verteilte die Dossiers. Ich hatte mich längst nicht so gut amüsiert wie erwartet. Die Auseinandersetzung zwischen Schmelzer und dem General berührte dermaßen kritische Punkte unseres Projekts, dass auch in mir ein ungutes Gefühl zurückblieb. Ein Gefühl, das mir jedes Mal die Laune verdarb, wenn ich über mögliche moralische Rechtfertigungen und die Frage nach deren Notwendigkeit nachgrübelte, um einen Ausweg zu finden, den es nicht gab. »Wir haben vor zwei Jahren eine Neurekrutierung ins Auge gefasst, die wir dann aus prinzipiellen Gründen unterlassen haben. Ich darf betonen, dass einige meiner damaligen Vorschläge trotz neuerlicher Prüfung heute noch Bestand haben. Das soll nicht als Beleg für meine Faulheit gelten, sondern als Beweis für meine schon damals vorhandene Sorgfalt.« Ich startete meinen Vortrag in einem bewusst spielerischen Tonfall, um die negativen Schwingungen, die den Raum elektrisierten, zu entschärfen. »Da wäre Pamela Dickinson, 28 Jahre, verurteilt zu lebenslanger Haft wegen Muttermord. Ziemlich kaltblütig, hochintelligent und organisiert. Dann hätten wir Sarah Nelson, 26 Jahre, verurteilt zu lebenslänglich wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge ....« Ich ging meine komplette Liste durch, verlas Namen, Daten, psychologische Gutachten und die Intelligenz- und Emotionsquotienten. Der General schien sich nicht für die Details zu interessieren. Ihm war völlig egal, welche Delinquentin an ihn überstellt wurde. Er betrachtete die Frauen als Ware: Menschenmüll, den er in eine verwertbare Form presste. Schmelzer hingegen vertiefte sich eingehend in die Fotos, lauschte meinen Ausführungen und studierte aufmerksam den der Akte beigefügten Hormonstatus jeder einzelnen Kandidatin. »Pete, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber ich fürchte, mit dieser Angie Helwood wird es nichts werden. Ihr Thyroxinspiegel ist zu hoch, sie ist schon von Natur aus hyperaktiv und könnte mit C15-Injizierungen völlig aus der Balance geraten.« »Ihr Psychogramm erscheint außerordentlich stabil, Professor Schmelzer«, wandte ich ein. Doch ich besann mich eines Besseren und grinste in die Runde. »Wie wäre es stattdessen mit Jacky? Vor zwei Jahren wollten Sie ihn nicht, weil er, also sie, eine Transe ist, aber vielleicht sind Sie inzwischen toleranter geworden. Ich sage Ihnen, Jacky ist phänomenal. Suuuperweiblich, hyyypersensibel, jederzeit passend gekleidet, und einen Busen hat sie ...« March und Schmelzer grinsten. Das war es, was sie an mir mochten: Alle fühlten sich mies – bis auf den General, der erklärtermaßen gar nicht fühlte und dieses Manko als Stärke zur Schau stellte –, und ich fischte sie mit einem niveaulosen Witz aus einem trüben Tauchgang ins Riff der Bedenklichkeiten. Ich spielte schon immer den Clown, wusste dabei aber nie, warum und für wen eigentlich. Es war eine dumme Angewohnheit. Wenn man von Jacky absah, wurden alle meine Vorschläge akzeptiert. Angie Helwood und eine andere wurden als Reserve eingestuft. March nahm die Liste an sich und beauftragte mich, die beiden projektgebundenen Headhunter loszuschicken. Sie sollten den acht betreffenden Frauen ihre Alternativen zur lebenslangen Haft oder der Todeszelle aufzeigen. Dann verabschiedete er sich und verließ eiligen Schrittes den Konferenzraum. Walcott tat es ihm nach, sodass Schmelzer und ich allein zurückblieben. Wir schauten uns etwa eine Minute lang wortlos an. Schließlich fragte Schmelzer: »Seit wann wissen Sie von der Erweiterung des Projekts?« »Seit vier Wochen«. entgegnete ich schuldbewusst. »Wieso haben Sie mir nichts gesagt?« »Als March mich anrief und mir den Auftrag gab, neue Akten zusammenzustellen, behauptete er, es sei lediglich eine Option, aber noch nicht sicher. Deshalb bat er mich, weder Sie noch Walcott zu informieren. Er wollte unnötige Diskussionen im Vorfeld vermeiden. Tut mir leid, Professor, aber abgesehen von der verteufelten Geschichte mit der Neun kann ich Ihre vehemente Ablehnung nicht nachvollziehen. Wenn der Job Sie so belastet, warum steigen Sie nicht aus?« Schmelzer packte seine Unterlagen ein. »Lassen Sie uns einen trinken gehen, Pete. Ich bin nicht böse auf Sie, Sie haben keine Schuld. Ich bin einfach nur frustriert. Die Kontrolle über meine Entdeckung ist mir genommen worden, der ursprüngliche Verwendungszweck pervertiert. Trotzdem bin ich verantwortlich. Deswegen steige ich nicht aus. Es würde nur Walcott in die Hände spielen ... Lassen Sie uns gehen, ich brauche einen Whisky.« Ich stand auf und nahm, was mich selbst verdutzte, Schmelzer die Aktentasche aus der Hand. Schmelzer grinste. »Das ist ja niedlich. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie meine Kondition beleidigen wollen. Aber nehmen Sie nur, tragen Sie einen Teil meiner Last, Sie Sensibelchen vom Secret Service!« Dabei fing er laut an zu lachen, und er lachte immer noch ein wenig, als wir schon in meinen Wagen stiegen. 3. Das Ausbildungslager Tina, 29, Sensor Stufe 6 Wir im Lager hatten keine Kenntnis von der Sitzung. Noch nicht. Für uns lief alles ganz normal. Soweit an unserem Leben überhaupt etwas als normal bezeichnet werden kann. Vermutlich ungefähr zur gleichen Zeit, zu der Pete und der Professor das Weiße Haus verließen, um in den Lärm der Rushhour von Washington einzutauchen, trat ich nach meinem Spüldienst einige tausend Meilen weiter südlich in Roswell, New Mexico, aus der Lagerküche ins gleißend helle Tageslicht. Als ich die Blechtür geöffnet hatte, war mit mir eine Fliege hinausgelangt, die nun durch die nachmittägliche Stille summte. Sie hatte sich in der Küche an den in der Hitze vertrocknenden Essensresten auf herumstehenden Tellern gütlich getan und steuerte nun den Schuppen mit den Wassertanks an. Mein Blick folgte ihr, denn wir bekommen selten etwas Lebendiges zu sehen hier in der Wüste. Wir selbst sind nicht wirklich lebendig, würde ich mal sagen, und unsere Aufpasser, die wir ´Schatten` nennen, auch nicht. Wir sind begraben, alle zusammen, in endlosen Schichten von Sand und Staub. Die Lagergebäude, einstöckig und mit Dachpappe oder Wellblech gedeckt, stehen seit auseinander. Zwischen den einzelnen Hallen des stillgelegten Militärflughafens befindet sich nichts – nichts als heiße, im Sonnenlicht flirrende Luft, die sich schwer auf die sandige Ebene legt. Hitze, die alles Leben ausdörrt, und Sand, der in jede Ritze dringt und sie verschließt. Die alten Start- und Landebahnen sind versandet, genauso wie die ursprünglich angelegten Wege zwischen den vor Jahrzehnten erbauten schlichten Unterkünften. Der asphaltierte Platz, um den sich die Gebäude gruppierten, liegt ebenfalls unter einem dicken, weichen Sandteppich begraben. Das Einzige, was die graugelbe Tristesse aus Sand, Blech und Beton unterbricht, ist eine Gruppe von blühenden Feigenkakteen an der Vorderfront des großen Hangars gegenüber der Unterkünften. Dort ließ sich die Fliege nieder. Doch kaum hatte sie begonnen, mit ihren langen Beinen gemächlich den Staub von den Flügeln zu putzen, wurde die Wellblechtür des Hangars unsanft aufgerissen und krachte gegen die Wand. Rebecca Winslow, von uns allen nur Becky genannt, taumelte aus der Halle heraus. Die kurzen braunen Locken klebten ihr an der Stirn. Ihr Gesicht war kalkweiß, der Körper bebte. Ihr Schatten Robert, der hinter ihr aus der Halle trat, stützte sie. Das grelle Sonnenlicht, das ihr plötzlich in die Augen stach, nahm ihr für eine kurze Weile jede Sicht. Sie verlor die Orientierung, dann das Gleichgewicht und sank in den Staub. Robert packte sie mit eisenhartem Griff am linken Oberarm und versuchte wortlos, sie wieder hochzuziehen, doch sie wehrte sich energisch, fast hysterisch und spuckte in hohem Bogen ihren Mageninhalt heraus. Robert ließ sie sofort los und trat einen Schritt zurück, damit Becky nicht auf seine Schuhspitzen kotzte. Wie alle unsere Aufpasser trug er Zivilkleidung und zeichnete sich durch nichts auf den ersten Blick Auffälliges aus, außer vielleicht durch seine vollkommen ungerührte Haltung. Er rückte seine Sonnenbrille zurecht, verschränkte die Arme hinter dem Rücken und betrachtete prüfend den strahlend blauen Himmel, als gäbe es tatsächlich Hoffnung auf eine kleine, die Sonne für Sekunden verdunkelnde Wolke. Als Becky nichts mehr im Magen hatte, was sie von sich geben konnte, und nur noch trocken würgte und hustete, trat Robert wieder an sie heran, packte sie wie vorher am Oberarm und schleifte sie mitleidlos über den großen Platz zu den Unterkünften. Ich hatte mich nicht eingemischt. Aus Erfahrung wusste ich, dass das besser war. Als die beiden an mir vorbeikamen, knurrte mich der Schatten an: »Kümmere dich um sie. Stell sie unter die Dusche, sie stinkt erbärmlich.« Abrupt ließ er Becky in den Staub fallen und stapfte ohne einen weiteren Blick hinüber ins Kasino, um sich die Hitze, den Sand und den Ekel mit ein oder zwei Bieren die Kehle runterzuspülen. Ich hievte die halb bewusstlose Becky hoch, schleifte sie zu den Baracken, stieß die Tür mit dem Fuß auf, schleppte Becky über die Schwelle durch den Flur in ihr Zimmer und legte sie auf ihr Bett. Ich setzte mich zu ihr und nahm sie beruhigend in die Arme. »Ist ja schon gut, schon gut, Kleines«, murmelte ich leise und strich ihr die Haare aus der Stirn. »Komm, wir gehen dich erst einmal waschen, kaltes Wasser wird dir gut tun, außerdem stinkst du wirklich. Dann trinkst du etwas und erzählst mir, was los war.« »Ja, trinken, ich will trinken«, krächzte Becky. Sie löste sich aus meinen Armen und strauchelte zum Waschbecken. Sie drehte den Hahn auf, hielt ihren Kopf darunter und trank wie eine Verdurstende. Sie trank so hastig, dass sie sich verschluckte, husten musste und den Handrücken auf den Mund presste, weil sie fürchtete, sich noch einmal zu übergeben. Es dauerte einige Minuten, bis sie wieder ruhig atmen konnte. Becky nahm ein Handtuch, rubbelte über ihre nassen Haare und warf sich erschöpft auf den riesigen alten Ohrensessel, der neben dem Schreibtisch stand. Der Sessel war ihr einziges privates Möbelstück. Die Grundausstattung der relativ geräumigen Zimmer war bei uns allen gleich karg und phantasielos. Sie bestand aus einem Einzelbett, das den mangelnden Komfort einer Pritsche nicht überbot, einem dünn furnierten Schrank mit Doppeltür, einem unbequemen Stuhl und einem kleinen Schreibtisch, der von den meisten Frauen im Lager als Frisierkommode genutzt wurde. Es war uns allerdings erlaubt, die spartanische Ausstattung unserer Räumlichkeiten durch private Möbelstücke oder persönliche Gestaltungswut zu ergänzen, ebenso wie das Tragen der eigenen Kleidung gestattet war. Auch in diesem Punkt hatte sich der Professor gegen den General durchgesetzt. Der General hätte das Lager am liebsten wie ein Militärgefängnis geführt, ohne jegliche Zugeständnisse. Walcott waren nicht nur Anns ultrakurze Miniröcke, Karens Punkfrisur und Sarahs durchsichtige Blusen zuwider, sondern auch die Poster von Filmstars an den Wänden, die künstlichen Blumengestecke, die Kuschelkissen und was sich sonst in unseren Zimmern an persönlicher Habe befand. Ich ging zur Gemeinschaftsküche unserer Unterkunft und holte zwei Cokes aus dem Kühlschrank. Weder auf dem Flur noch im ebenfalls gemeinsamen Wohnzimmer traf ich eine der anderen Ratten. Ich war froh, dass sie bis jetzt nichts von dem neuerlichen Zwischenfall mitbekommen hatten. So konnte ich zuerst allein mit Rebecca reden. Ann und Karen, die anderen beiden Vierer neben Becky, trieben sich im Kasino herum und flirteten mit Walcotts Männern. Die beiden konnten Beckys Schwierigkeiten nicht nachvollziehen. Sie waren auf der gleichen Stufe und hatten längst keine Probleme mehr mit Übelkeit und Kreislaufstörungen. Im Gegenteil: Die hartgesottenen New Yorkerinnen, die hier beide ihren Todesurteilen wegen mehrfachen Mordes zu entgehen hofften, empfanden kein Mitleid für Becky. Meistens machten sie sich über sie lustig, beschimpften sie als Heulsuse und warfen ihr vor, die uns allen schwer erträgliche Situation durch ihre Zusammenbrüche nur noch zu verschlimmern. Die beiden Fünfer, also Jessica, verurteilt zu lebenslänglich wegen Entführung ihres eigenen Babys, und Sarah, ebenfalls lebenslänglich wegen Verursachung eines tödlichen Unfalls unter Alkoholeinfluss, saßen in der Zentrale bei Gustafsson und spielten Computerspiele auf der dort installierten Mediawand. Gustafsson, ein dicklicher Däne von zweifelhaftem Charakter, gestattete ihnen diesen harmlosen Zeitvertreib, wenn Walcott verreist war, weil ihm Sarah dafür gelegentlich erlaubte, mit ihrer Muschi zu spielen. Isabel, die zweite Sechs, die neben mir im Lager war, lag mit einer aus dem Kasino entwendeten Flasche Whisky auf ihrem Bett und ließ sich volllaufen. Mir sollte es egal sein, ich musste mich um Becky kümmern. Als ich zurück in ihr Zimmer kam, hatte sie sich wieder gefasst. Ich reichte ihr eine Coke, setzte mich im Schneidersitz aufs Bett. »Was war los, Becky? Die letzten beiden Male ging es glatt, da hast du dich nicht übergeben. Wieso der Rückfall?« Becky zündete sich eine Zigarette an, ihre Hände zitterten ein wenig. »Ach, fuck, drauf geschissen. Was soll ich sagen? Im ersten Jahr wars die Angst vor den Spritzen. Im zweiten Jahr hatte ich Angst vor der Übelkeit. Im dritten Jahr hatte ich Angst, ich versage, und sie schicken mich zurück in den Bau. Na ja, und eben, als ich drin war, lief zuerst alles super. Ich hab schon gedacht, geil, die ganze Scheißangst hab ich hinter mir. Aber kaum war das in meinem Kopf, da gings los ... Die Scheißangst, dass es vielleicht n Irrtum ist und ich wieder diese Scheißangst bekommen könnte. Scheißangst vor der Angst. Verstehst du?«, fügte sie lächelnd hinzu. »Du spinnst. Sie haben noch nie jemanden zurückgeschickt. Außerdem vertraut der Professor auf deine Fähigkeiten. Er wird nicht zulassen, dass Walcott dich aussortiert.« »Aber wenn ich da drinnen bin, krieg ich Panik, und ich kann absolut nicht unterscheiden, ob die Panik durch meine Angst vor der Angst kommt oder ob mein System alarmiert, weil etwas präpariert ist. Ich reagiere einfach höllisch heftig auf große Mengen Sprengstoff, und das weiß dieser Scheißschatten. Ich wette, der hat mir heute zwei Zentner TNT untergejubelt, nur um mich kotzen zu sehen. Außerdem hat er mich auf vier Einheiten geprüft und nicht auf die erlaubten zwei, dieses Schwein! Bei den Schusswaffen habe ich noch sauber alarmiert. Aber beim Sprengstoff bin ich ausgeflippt.« Becky atmete tief durch, dann straffte sie sich. »Was solls. Die Atemtechniken, die du mir gezeigt hast, bringen was. Mach dir keine Sorgen, ich bekomm das in den Griff. Es ist verdammt heiß heute, das nächste Mal hab ich die Kontrolle.« Entschlossen zerquetschte sie ihren Zigarettenstummel im Aschenbecher. »Schätzchen, in diesem Rattenloch hier ist es immer verdammt heiß«, meinte ich skeptisch. »Ich habe eher das Gefühl, dass du dich noch sperrst. Du musst endlich begreifen, dass Angst, Panik und Paranoia unser Alltag sind. Erst wenn du das akzeptierst, kannst du anfangen, das alles als Instrument zu nutzen. Erst dann kannst du vernünftig arbeiten. Wir sollten noch einmal die kompletten Differenzierungen der emotionalen und biologischen Reaktionen durchgehen.« »Bloß nicht, nicht jetzt«, stöhnte Becky auf. »Ich bin fix und fertig.« »Okay, wir setzen uns morgen daran. Und übermorgen. Und überübermorgen ... Jetzt ruh dich aus.« Becky schien jedoch schon wieder recht munter. »Wo sind Jessica und Sarah?« »Ich fürchte, bei Gustafsson.« »Wie schön für den Dänen. Darf er mal wieder abspritzen?«, stieß sie sarkastisch hervor. »Ich geh rüber, hoffentlich sind sie mit ihrem Schweinkram fertig, und wir können was starten.« Becky sprang fröhlich auf und lief aus dem Zimmer, ohne sich noch einmal umzudrehen. Man konnte kaum glauben, dass sie sich vor einer halben Stunde noch die Seele aus dem Leib gekotzt hatte. Ich ging auf mein Zimmer. Beckys Abgang ohne ein Wort des Dankes war nicht böse gemeint, sondern ein Zeichen für ihre perfekten Verdrängungsmechanismen. Sie verdrängte ihre Vergangenheit, sie wollte sich nicht mit der Gegenwart auseinandersetzen und schon gar nichts über die ihr bestimmte Zukunft wissen. Genau diese Verweigerungshaltung machte ihr das Arbeiten unmöglich. Selbst Esther, unsere Lagerpsychologin, hatte diesen offensichtlichen Umstand erkannt. Ich hielt Esther für dämlich und verspürte wie die anderen Frauen im Lager keine Lust, mich mit der Seelenklempnerin auseinanderzusetzen. Doch eine Sitzung pro Woche war Pflicht. Manchmal machten wir uns einen Spaß daraus, Träume und Neurosen vorher untereinander abzusprechen, und wetteten auf die Plattitüden, mit denen die Psychologin uns zu therapieren suchte. Die Trefferquote war hoch. Am meisten nervte Esther jedoch mit ihrem Entschluss, uns Ratten als »ganz normale Frauen« zu behandeln. Folgen davon waren eine stets verkrampfte, sich der Lächerlichkeit preisgebende Therapeutin und Patientinnen, die es amüsant fanden, sich in den Sitzungen als Monster und Mutanten aufzuführen. Die Stunden auf Esthers Couch waren sinnlos. Lediglich Becky ging seit einiger Zeit jede Woche zweimal hin. Allerdings nur, weil sie mit Ann gewettet hatte, dass sie die verklemmte Psychologin ins Bett zerren würde. Sie provozierte Esther, wo sie nur konnte. Einmal hatte sie auf der Couch zu masturbieren begonnen, wobei Esther puterrot anlief und sich nur mühsam beherrschen konnte, ihren distanzierten Psychologentonfall beizubehalten. Als Becky nach dieser Sitzung ins Wohnzimmer kam und uns Esthers schale Einwürfe wie »Warum tust du das? Fühlst du dich als Lesbe von mir nicht akzeptiert?« zum Besten gab, war die Stimmung so heiter wie schon lange nicht mehr. Dennoch – dass wir bei Schmelzer nicht um eine andere Psychologin baten, lag schlichtweg daran, dass die studierten Schmeißfliegen, die an unserer Seele schmarotzten, uns allesamt gestohlen bleiben konnten. Jede einzelne der im Lager anwesenden Ratten hatte ihre einschlägigen Erfahrungen mit Sozialarbeitern, Gutachtern und Therapeuten schon im Knast gemacht. Das genügte uns für den Rest des Lebens. Ich legte mich aufs Bett und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Mit Isabel, der anderen Sechs, war ich die Dienstälteste im Lager und deshalb für die Ausbildung der unteren Stufen mitverantwortlich. Die letzte Schulung durch Ratten höherer Grade war schon lange her. Ich musste an Lucy und Katya denken, von denen ich ausgebildet worden war. Am besten würde ich mich mit den beiden wegen Becky in Verbindung setzen. Sie wussten bestimmt Rat. Ich würde Schmelzer bei seinem nächsten Besuch eine Nachricht für Lucy mitgeben. Auf Schmelzer konnte man sich verlassen. Leider würde er es vermutlich nicht mehr rechtzeitig für mich schaffen, die Freistellung der Ratten aufs sechste Jahr runterzudrücken. Aber nächstes Jahr! Nächstes Jahr würde ich freigestellt werden, konnte das Lager ohne Schatten verlassen, mir eine Wohnung suchen und müsste nur noch gelegentliche Routineüberprüfungen über mich ergehen lassen. Lucy hatte mir erzählt, dass diese Checks kein Problem waren. Ab Stufe acht war man sogar für solche minimalen Störungen sensibilisiert. Ich war gespannt, in welche Stadt man mich beordern würde. Hoffentlich New York. Ich würde einkaufen gehen können, ins Kino, ins Restaurant, in die Disco, in den Zoo – wohin ich nur wollte. In eine Bar vielleicht, bummeln oder im Park auf einer feuchten Wiese liegen. Essen kochen. Besuch empfangen. In einem großen Doppelbett zwischen kühlen Laken schlafen. Im Regen spazieren gehen. Wolken sehen, ja Wolken, vielleicht im Winter sogar Schnee. Die Vorstellung eines grauen, mit Regen- oder Schneewolken verhangenen Himmels brachte mich zum Lächeln. Dieser permanente Sonnenschein, dieser ständig blaue, endlose Horizont konnte einen wirklich deprimieren. Früher hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die Sonne mir jemals auf den Wecker gehen würde. Ein Urlaub am Meer mit zwei Wochen satter UV-Strahlung, am besten auf Hawaii, war das Größte für mich gewesen. Faul am Strand herumliegen und die salzwassernassen Zehen in den Sand graben. Wenn damals nicht diese Scheiße bei dem Überfall passiert wäre, mit dem ich den Rest meines Studiums finanzieren wollte, dann wäre ich womöglich nach Hawaii gezogen. Hätte mich von meinem Macker getrennt – er war eh bloß ein verdammter Dreckshaufen gewesen – und mir einen Job als Hotelmanagerin gesucht. Jetzt war alles anders. Jetzt hatte ich die Nase voll von Sand und Sonne. Jetzt träumte ich von Regen in New York. Den Job allerdings konnte ich mir nicht mehr aussuchen. Vielleicht blieb ich ja mit Isabel zusammen, und wir konnten uns zusammen eine Wohnung nehmen. Wie Lucy und Katya. Denen gings doch verdammt gut in Washington.
In einer Zeit, in der in den in den USA Terroranschläge überhand nehmen und die Regierung Probleme hat, diese einzudämmen, benötigt der Präsident persönlichen Schutz. Zuständig dafür sind Frauen, ehemalige Gefangene, die zu Sensoren ausgebildet wurden und verstecke Waffen oder Sprengstoff erkennen können. Dementsprechend setz ich der Präsident und seine Gefolgschaft für eine Vergrößerung des geheimen Projekts an. Doch die Behandlung ist nicht ganz risikofrei und die Frauen beginnen,...
Stell dir vor, du sitzt im Gefängnis. Jemand ist bereit, dich zu befreien, dir eine zweite Chance zu geben. Du hast die Möglichkeit, deinem Land zu dienen und Menschen zu retten. Doch die Ausbildung ist hart, die Umwandlung schmerzhaft und die Nebenwirkungen unbekannt. Stell dir vor, dir bleibt keine Wahl...
Es ist die Sensation. Frauen aus Gefängnissen werden rekrutiert und genmanipuliert. Es entstehen Wesen, die Sensoren genannt werden. Menschliche Frühwarnsysteme, die Katastrophen...
Das Buch befindet sich in 2 Regalen.