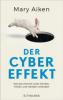Unser Cyber-Ich - und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Internetzeitalter
Bewertet mit 3 Sternen
Mary Aiken liegt der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet besonders am Herzen. Die virtuelle Welt sei für Erwachsene geschaffen und halte kein Nichtschwimmerbecken für Anfänger bereit, weil jeder Teilnehmer als gleich betrachtet würde. Ob der Einfluss von digitalen Geräten zur Internetnutzung der Entwicklung von Kindern schadet, untersucht sie in ihrem schon 2016 im Original erschienen Buch. Bereits 3-Jährige besitzen heute eigene Tablets, Schulanfänger eigene Profile in den sozialen Medien. Zuletzt ereiferten sich auch deutsche Medien über Eltern, deren Kinder verunglückten oder ertranken, während ihre Eltern - angeblich - gerade mit ihren Smartphones beschäftigt waren. Ein weiterer Auswuchs der schönen neuen Welt seien Babywippen mit einer Handy-Halterung zur akustischen Bespaßung des Nachwuchses.
Aikens Streitschrift ist gegliedert in jeweils ein Kapitel zum Babyalter, zu Kindern von 4-12 Jahren und zu Jugendlichen. Es befasst sich außerdem mit bestehendem Suchtverhalten, das im Internet ausgelebt wird, und der konkreten Sucht, Zeit im Internet zu verbringen. Kurze Kapitel handeln jeweils von Partnerschaft und Dating im Internetzeitalter, Cyberchondrie (internetgestützter Hypochondrie), dem Darknet und einem Ausblick in die Zukunft des Cyberspace. Nach einem sehr vernünftigen Kapitel über Eltern-Kind-Bindung im Smartphone-Zeitalter war zentraler Teil ihres Buches für mich das Kapitel über Jugendliche, die ihr alterstypisches Risikoverhalten und ihre Lust an der Selbstdarstellung in sozialen Medien und Multiplayer-Games ausleben. Wichtige Erkenntnisse der Lektüre sind das Informationsgefälle zwischen Eltern und Kindern und die daraus oft resultierende Resignation betroffener Eltern, die Verschiebung von Normen und die Entwicklung von Narzissmus einer ganzen Gesellschaft. Allerdings kann auch die Cyberpsychologin nicht belegen, welcher Anteil an narzisstischem Verhalten in einer Gesellschaft der Pflege des Cyber-Ichs in sozialen Medien zuzuschreiben ist und welcher anderen Entwicklungen in den letzten 20 Jahren.
Nach eigener Aussage arbeitet Aiken gern mit Beispielen des Boulevardjournalismus, sie formuliert deutlich talkshowgerecht. Leider sind ihre Beispiele zum großen Teil schon älter und zigfach in den Medien abgenudelt. Ihre Aussagen belegt sie mit fast 400 empirischen Untersuchungen und Zitaten, die sich häufig auf Verhältnisse in den USA beziehen. Eine zitierte Befragung von Kindern zu ihrem Umgang mit dem Internet wurde erkennbar in Europa durchgeführt. Bei nahezu allen anderen Fundstellen ist für mich nicht ersichtlich, ob die Ergebnisse überhaupt auf Deutschland oder Europa übertragbar sind. Für betroffene Eltern ist z. B. der Abschnitt über ADHS-Diagnosen in Zusammenhang mit Internet- und Fernsehkonsum wichtig, aber auch hier frage ich mich, ob amerikanische Verhältnisse sich einfach so übertragen lassen.
Mary Aiken fordert zwar Eltern auf, ihr Buch zu lesen, sein Umfang von rund 500 Seiten und ein fehlendes Stichwortregister erschweren den Zugang jedoch unnötig. Aus dem Inhaltsverzeichnis geht z. B. nicht hervor, dass sie konkret auf drei Phasen in der kindlichen Entwicklung eingeht. Hätte ich das gleich erkannt, hätte ich mir einen Teil des Textes gespart. Wenn ein 9-Jähriger sich aktuell bei Instagram registrieren will, möchten dessen Eltern den Abschnitt zu sozialen Medien evtl. zuerst lesen. Wenn ich auf das ADHS-Thema treffe, hätte ich gern einen Verweis, ob und wo das Thema evtl. noch schwerpunktmäßig behandelt wird.
„Der Cyber-Effekt“ ist zwar populärwissenschaftlich geschrieben mit deutlicher Tendenz zu Boulevard-Themen, das Buch wird dadurch jedoch nicht leichter lesbar. Zu ausschweifend, fehlendes Stichwortregister, zu stark auf USA-Verhältnisse bezogen.