Hallo lieber Besucher! Noch kein Account vorhanden? Jetzt registrieren! | Über Facebook anmelden

Hallo lieber Besucher! Noch kein Account vorhanden? Jetzt registrieren! | Über Facebook anmelden

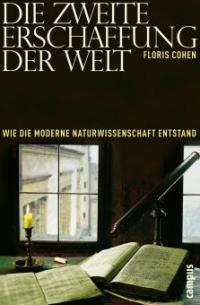
I. Um am Anfang anzufangen: Naturerkenntnis im alten Griechenland und in China
Die uns umgebende Natur ist eindrucksvoll, aber auch rätselhaft. Um sie sich gefügig zu machen, in Zeiten der Dürre oder der Pest zum Beispiel, vertraute man auf die magische Beschwörung. Und um sie erklärend in den Griff zu bekommen, brauchte man die Götterwelt. In der Ilias und der Odyssee findet sich eine Menge dieser Erklärungen: Bei Gewitter donnert Zeus (Jupiter); wenn ein Vulkan ausbricht oder die Erde bebt, tobt Hephaistos (Vulcanus) in seiner Schmiede; bei Regen im Sonnenschein beeilt sich Iris, einen Bogen an den Himmel zu setzen. In den Götterwelten anderer Kulturen ging es ebenso zu, nur mit anderen Personifikationen. Derartige Naturerklärungen ließen durchaus die Möglichkeit offen, auf diesem oder jenem Teilgebiet tiefer in das Wesen der Erscheinungen einzudringen. So brachten es die Babylonier zu bemerkenswert genauen Vorhersagen der Positionen von Mond, Sternen und Planeten, indem sie systematisch deren Bahnen am Nachthimmel verfolgten. Und so gelang es den Polynesiern dank genauer Beobachtung kleinster Nuancen bei Wolkenformationen oder beim Vogelzug, in ihren Kanus zuverlässig den Weg über Hunderte von Meilen auf dem Ozean zu finden.
Nicht wenige Kulturen haben sich im Lauf der Zeit solches Spezialwissen über die Natur angeeignet, zwei sind einen entscheidenden Schritt weiter gegangen. Das waren im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die griechische und ungefähr gleichzeitig die chinesische. Beide ließen Naturerklärungen des Typs Zeus-Hephaistos-Iris hinter sich und formten sich ihr Bild von der Welt auf völlig anderer Grundlage. Nicht, dass sie von ihrem Glauben an Götter oder Geister abgekommen wären. Nur schrieben sie ihnen nicht mehr die unendliche Mannigfaltigkeit der Naturphänomene zu. Stattdessen entwarfen sie Ordnungsprinzipien und erklärende Schemata, die sie in die Lage versetzten, die Natur in ihrer Gesamtheit nach einigen wenigen Leitideen zu deuten und weiter zu erkunden.
Wie man einer Mahlzeit sowohl mit Messer und Gabel als auch mit Stäbchen zu Leibe rücken und wie man Sprache sowohl mit Buchstaben als auch mit Logogrammen schriftlich festhalten kann, so kann man auch die Naturphänomene auf ganz unterschiedliche Weise angehen und übersichtlich einteilen. Tatsächlich sehen in der griechischen Kultur die Herangehensweise und die Einteilung völlig anders aus als in der chinesischen. Der chinesische Ansatz war vor allem an den Erfahrungstatsachen ausgerichtet und auf die Praxis bezogen. So versuchte Zhang Heng im 2. Jahrhundert n. Chr. eine Regelmäßigkeit im Vorkommen von Erdstößen zu entdecken, um rechtzeitige Warnungen zu ermöglichen. Solche von der Beobachtung ausgehende Forschung wurde vor dem Hintergrund eines zusammenhängenden Weltbildes betrieben, das sich langsam herauskristallisiert hatte und in dem alle Erscheinungen ihren Platz zugewiesen bekamen. Der griechische Ansatz dagegen war kein "Bottom-up-Approach" wie der chinesische, sondern "Top-down" - die Generalisierung ging dem Sammeln von Daten voraus, Erfahrungstatsachen wurden in eine intellektuelle Konstruktion eingepasst. Eine Verbindung zu praktischen Fragen gab es kaum, das Denken war abstrakt und theoretisch. Und während in China nach der Einigung des Reiches unter einem Kaiser eine Synthese zustande kam und von da an die eine Vorgehensweise und das eine Weltbild im Großen und Ganzen festlagen, vollzog sich im griechischen Denken eine dauerhafte Spaltung. In Athen nahmen Abstraktion und Theoriebildung die Gestalt der Philosophie an, in Alexandria die der Mathematik. Zum Beispiel erklärten in Athen Philosophen in groben Zügen, wie die Erde sich zum Rest des Kosmos verhält, während in der griechischen Kolonie Alexandria Mathematiker Modelle der Planetenbahnen am Himmel berechneten.
Die Aufspaltung in einen athenischen und einen alexandrinischen Ansatz ist von entscheidender Bedeutung. Ohne eine genauere Kenntnis der zwei getrennten Wege lässt sich die viel spätere Entstehung der modernen Naturwissenschaft nicht angemessen erklären, und deshalb gehen wir von dieser Zweiteilung aus. Wir betrachten zunächst die athenische Form der Naturerkenntnis, danach die alexandrinische, um schließlich zu fragen, worin die wichtigsten Unterschiede bestanden und wie tief die Spaltung war.