Hallo lieber Besucher! Noch kein Account vorhanden? Jetzt registrieren! | Über Facebook anmelden

Hallo lieber Besucher! Noch kein Account vorhanden? Jetzt registrieren! | Über Facebook anmelden

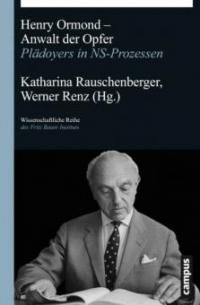
Einleitung
Katharina Rauschenberger, Werner Renz
Henry Ormond (1901-1973) war in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts einer der erfolgreichsten Frankfurter Anwälte sowohl im Bereich des Wiedergutmachungs- und Rückerstattungsrechts als auch auf dem Feld des Strafrechts in Prozessen wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. Seine Biographie ist jedoch nur wenigen bekannt. Seine persönlichen Erfahrungen besonders mit dem Antisemitismus in der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch sein Leben im englischen Exil und nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik haben sein anwaltliches Engagement für NS-Opfer und seine Rechtsauffassungen entscheidend geprägt. Diese biographische Skizze soll dazu beitragen, die im vorliegenden Band dokumentierten Plädoyers Ormonds, gehalten in drei ausgewählten Verfahren, historisch zu kontextualisieren. Die den Plädoyers und den Repliken vorangestellten Einführungen der Herausgeber legen sodann Ormonds Rolle in den einzelnen Prozessen dar. Als Hans Ludwig Jacobsohn kam Ormond am 27. Mai 1901 in Kassel zur Welt. Sein Vater Alex Jacobsohn war Getreidegroßhändler, die Mutter Amalie die Tochter eines Mannheimer Seifenfabrikanten. Die Eltern waren Juden, doch scheint die Religionsausübung im Elternhaus keine große Rolle gespielt zu haben. 1906 starb der Vater. Die Mutter kehrte daraufhin mit dem kleinen Jungen in ihre Heimatstadt Mannheim zurück und sorgte dafür, dass Hans aus der jüdischen Gemeinde austrat und in die Freireligiöse Gemeinde Mannheim aufgenommen wurde. Die freireligiösen Gemeinden waren ein ökumenischer Glaubenszusammenschluss, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts als Antwort auf unflexible Strukturen in der katholischen und evangelischen Kirche gebildet hatte. Viele aufgeklärte Christen und Juden, die im 19. Jahrhundert nach einer religiösen Orientierung suchten, schlossen sich den freireligiösen Gemeinden an. Sie vertraten einen liberalen Pantheismus, der als Sammelbecken für viele unspezifische Glaubensansätze anziehend wirkte. Man kann also davon ausgehen, dass Ormond zwar nicht jüdisch, aber auch nicht areligiös erzogen wurde. 1908 starb auch Ormonds Mutter an einer Typhusinfektion. Hans wurde von seiner Tante Karoline Luise und seiner Großmutter Jeanette großgezogen. Die Tante adoptierte ihn 1920 und gab ihm ihren eigenen Namen, Oettinger, der auch der Mädchenname der Mutter gewesen war. Ihr, einer zeitlebens unverheiratet gebliebenen, behinderten Frau, fühlte sich Ormond sehr verbunden, und er unterstützte sie in späteren Jahren, so gut er konnte, finanziell. Zwischen 1907 und 1910 besuchte er die Bürgerschule, dann das Karl-Friedrich-Gymnasium in Mannheim, wo er 1919 Abitur machte. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs war Hans 13 Jahre alt und leicht für Deutschlands Kriegserklärung zu begeistern. Später schilderte er, wie sehr er es bedauert habe, zu jung für einen aktiven Militärdienst gewesen zu sein. Ab 1919 studierte Hans Oettinger Rechtswissenschaften an den Universitäten Heidelberg und Berlin. Nach der ersten Staatsprüfung 1923 durchlief er im juristischen Vorbereitungsdienst verschiedene Stationen am Amts- und Landgericht in Mannheim, aber auch bei einem dortigen Rechtsanwalt, beim Notariat und bei der Polizeidirektion sowie in der Amtsanwaltschaft Pforzheim. Seine Neigung galt jedoch der Justiz, bei der er nach dem zweiten juristischen Staatsexamen 1926 bis auf ein Jahr Unterbrechung permanent beschäftigt war. In jenem Jahr, 1927, nämlich ließ er sich beurlauben, um bei der Rheinischen Treuhand-Gesellschaft AG in Mannheim als Syndikus zu arbeiten. Hier eignete er sich fundamentale Kenntnisse über die Funktionsweise eines privaten Unternehmens an. Danach kehrte er als Hilfsrichter an das Amtsgericht Mannheim zurück, 1929 war er für einige Monate Hilfsstaatsanwalt, bevor er am 1. Februar 1930 seine erste feste Stelle als Staatsanwalt in Mannheim antrat. Im November 1932 erhielt er die Ernennung zum Amtsgerichtsrat in Mannheim. Aus dieser Position wurde er am 31. Mai 1933 infolge des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen - und das, obwohl er keiner jüdischen Gemeinde mehr angehörte. Es muss einige Monate gedauert haben, bis er verstand, dass der Staat, dessen rechtstreuer Beamter er hatte sein wollen, sich nicht mehr schützend vor ihn stellen würde. Noch im Juni 1933 machte er eine Eingabe an das Justizministerium mit der Bitte um finanzielle Unterstützung und bewarb sich parallel um Stellen außerhalb des Staatsdienstes; dabei war eine Zulassung als Rechtsanwalt wegen der NS-Gesetzgebung schon nicht mehr möglich. Hans Oettinger zog nach Frankfurt am Main, wo er eine neue Anstellung als Wirtschaftsjurist fand. Seine Ausbildung und bisherige Laufbahn waren, wie die vieler Juristen, ganz auf den Staatsdienst ausgerichtet gewesen. Nun musste er umlernen. Dabei kam ihm sicher zugute, dass er vorübergehend bei der Rheinischen Treuhand-Gesellschaft AG beschäftigt gewesen war. Von Juli 1933 bis Juni 1938 konnte er als Handlungsbevollmächtigter und Syndikus der Kohlengroßhandlung Nirmaier & Co. arbeiten. Diese Jahre schien Oettinger noch in einem geschützten Raum zu verbringen. Hugo Nirmaier war gläubiger Katholik und entschiedener Nazi-Gegner. Er schätzte die juristischen Talente und die Persönlichkeit des entlassenen Richters und übertrug ihm in der Firma Verantwortung so weit wie möglich, ohne zu sehr nach außen aufzufallen. Oettinger konnte trotz der zunehmenden Repressionen gegen Juden sogar noch Urlaubsreisen nach Madeira (1934/35) und Sizilien (1936) unternehmen sowie eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer machen, die ihn 1937 zum ersten Mal nach Jerusalem führte. Auf Druck des Kreiswirtschaftsberaters der NSDAP musste ihn Nirmaier 1938 jedoch entlassen. Zwar konnte er Oettinger auch nach der offiziellen Entlassung noch illegal einige Monate weiterbeschäftigen, es war aber absehbar, dass dies nicht mehr lange möglich sein würde. Oettingers finanzielle Situation wurde ab Mitte 1938 immer schwieriger. Ein Gesuch um finanzielle Unterstützung lehnte der Oberlandesgerichtspräsident in Frankfurt am Main im September "aus grundsätzlichen Erwägungen" ab. Der entlassene Jurist begann, sich auf die Emigration vorzubereiten, besuchte Englischkurse und ging einige Wochen auf die Frankfurter Dienerfachschule und Servieranstalt Kotz, um seine Arbeitschancen im Ausland zu erhöhen. Er versuchte bei verschiedenen Konsulaten, unter anderem dem venezolanischen, ein Visum zur Einwanderung zu erhalten, hatte damit jedoch zunächst keinen Erfolg. Dann kam der Novemberpogrom 1938. Offenbar geriet Oettinger, der kein Funktionär einer jüdischen Gemeinde und auch sonst in der Öffentlichkeit nicht bekannt war, durch einen Zufall in den Fokus der Gestapo. Am 16. November 1938, wenige Tage nach dem Novemberpogrom, wurde er verhaftet, so erzählte er später, weil sein Vermieter, der eigentlich auf der Liste der Gestapo stand, krank und nicht transportfähig war. Oettinger wurde ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. Über diese Zeit sprach er später nicht viel, jedoch ist bekannt, dass er nur überlebte, weil ein Mitgefangener ihn bei einem tagelangen Appellstehen stützte. Von diesem Appell im Januar 1939, der 36 Stunden dauerte, trug Oettinger Erfrierungen an beiden Händen davon, die ihn zeitlebens beeinträchtigten. Seinem Antrag auf Entschädigung für die Freiheitsentziehung während der NS-Zeit wurde nach Widerruf des ersten ablehnenden Bescheids im Jahr 1953 entsprochen. Für die vier Monate, die Oettinger in Dachau inhaftiert gewesen war, erhielt er damals eine Entschädigung von 600 DM. Oettingers Entlassung aus Dachau am 17. März 1939 war mit der Auflage verbunden, bis zum 1. Juni 1939 Deutschland zu verlassen. Für eine Aufenthaltserlaubnis in Großbritannien oder in den USA brauchte man jedoch die Bürgschaft eines Staatsangehörigen des jeweiligen Landes. Tatsächlich bekam Oettinger ein sogenanntes Affidavit aus den Vereinigten Staaten. Es stammte von einem entfernten Cousin, Walter Dreyfus aus Mississippi. Da die USA jedoch restriktive Einreisequoten für Deutsche festgelegt hatten, bemühte er sich gleichzeitig auch um eine Ausreise nach Großbritannien. Aus London traf Ende März 1939 die Nachricht ein, dass sich mehrere Engländer dafür einsetzten, ihm zumindest eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis zu verschaffen. Diese Hilfe ging unter anderem auf das German Emergency Committee zurück, eine Hilfsorganisation der Quäker, die vielen Christen und Juden die Ausreise aus Deutschland ermöglichte. Eine junge Frau, Jean Finch, die Tochter eines anglikanischen Pfarrers, hatte erwirkt, dass dieses Committee eine Bürgschaft für Oettinger stellte. Sie hatte in einem Sanatorium in der Schweiz von ihrer Bettnachbarin aus Mannheim von seiner Situation erfahren. Diese Bürgschaft war die Voraussetzung für Oettingers Entlassung aus Dachau gewesen. Bei seiner Rückkehr aus Dachau fand er Briefe des Hilfskomitees und von Jean Finch vor, die ihm ihre Hilfsbemühungen schilderten. In seiner Antwort schrieb er:
"Ich weiß nicht, sehr verehrte gnädige Frau, ob Sie sich eine Vorstellung davon machen können, wie mir nach dem Vorausgegangenen zu Mute war, als ich so viele Beweise menschlicher Anteilnahme und Hilfsbereitschaft einem wildfremden Menschen gegenüber zu Gesicht bekam. Gleichgültig ob Ihre Bemühungen Erfolg haben werden oder nicht, es tut so gut, so unendlich gut, statt Demütigungen und Missachtung ein Entgegenkommen in solchem Ausmaß zu finden und einen so starken Willen zum Helfen zu spüren, wie er aus Ihren ausführlichen und mitfühlenden Zeilen spricht."
Bis Oettinger die erforderlichen Papiere tatsächlich vorlagen und er ein Visum beantragen konnte, vergingen jedoch noch einige Wochen, in denen die Ungewissheit unerträglich gewesen sein muss. In dieser Zeit verließ er die Freireligiöse Gemeinde und trat der Frankfurter Jüdischen Gemeinde bei; er bot sich dem Frankfurter Jüdischen Hilfsverein an, der Ausreisewillige beim Ausfüllen von Formularen und bei der Kontaktaufnahme mit Ämtern unterstützte, und wechselte schließlich zum Hilfsverein nach Berlin, wo solche Hilfe noch dringender benötigt wurde. Am 19. Mai 1939 erhielt er die Nachricht, dass sein Visum bestätigt worden sei, es jedoch noch einige Zeit dauern könne, bis es beim Konsulat vorliege. Bei der Gestapo musste Oettinger daher eine Verlängerung seiner Ausreisefrist beantragen, die ihm auch gestattet wurde. Auf dem Umweg über die Schweiz verließ er Deutschland am 21. Juni 1939. Die Familie von Jean Finch nahm ihn in ihrem Haus auf. In Großbritannien galt er aber als enemy alien. Zwischen Sommer 1939 und Sommer 1941 wurde er von den britischen Behörden zunächst auf der Isle of Man, später in einem Lager in Kanada interniert. Nach seiner Rückkehr und Entlassung heirateten Hans Oettinger und Jean Finch am 16. August 1941. Oettinger war zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt, staatenlos, ohne Arbeit und ohne eine in England nutzbare Ausbildung. Er hatte die Verfolgung durch die Nazis überlebt, war aber in Großbritannien nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen worden. Seine Aufgabe sah er dennoch darin, die Briten bei der Bekämpfung des nationalsozialistischen Deutschland zu unterstützen. 1941 wurde er nach wiederholten Anträgen zur Aufnahme in die Britische Armee dem Pioneer Corps zugeteilt, später war er in einer Amplifier Unit eingesetzt, die für Propagandafragen zuständig war. Auf Anraten seiner militärischen Vorgesetzten - im Vorfeld der geplanten Invasion - änderte er am 23. Juni 1943 seinen Namen in Henry Lewis Ormond. Man befürchtete nämlich, sein deutscher Name könne ihm schaden, falls er in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet. Mit seiner Einheit kam Ormond im April 1945 nach Deutschland zurück. In seinem in Englisch verfassten Tagebuch beschrieb er die verzweifelten letzten Kämpfe der Wehrmacht, die großen Emotionen innerhalb seiner Einheit angesichts der Meldungen von den eingenommenen deutschen Städten und die ersten Kontakte mit der deutschen Zivilbevölkerung. Er notierte:
"None of us imagined this amount of subservience and docility and this obvious relief of having got rid of Nazism. I am strongly inclined to take it for honest and not faked amongst the civil population. We have lived with so many people, I have interrogated thousands of them and I have heard many people talking in the shops, in the streets, in offices, amongst themselves, people who don't expect me to understand German. And I find the same picture all over the show. It is a very interesting experience to me indeed, and I frankly admit, I didn't expect it."
Nach Kriegsende blieb Ormond bis 1948 in einer Information Control Unit der britischen Militärverwaltung, die den Aufbau eines demokratischen Kulturlebens in der britischen Besatzungszone überwachte und die Herausgabe deutscher Zeitungen genehmigte. Eine davon, an deren Gründung Ormond beteiligt war, war das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Gemeinsam mit Harry Bohrer aus seiner Einheit und ihrem Vorgesetzten John Seymour Chaloner rief er im September 1946 die Zeitschrift Diese Woche ins Leben. Für die Redaktion wurden junge, unbelastete deutsche Journalisten angeworben. Einer von ihnen war Rudolf Augstein. Als dieses Publikationsorgan mit einigen kritischen Artikeln über die mangelhafte Versorgung der deutschen Bevölkerung das Missfallen der Besatzungsmächte auf sich zog, wurden die Angehörigen der Britischen Armee kurzerhand von ihm abgezogen. Unter dem Namen Der Spiegel und Augsteins Leitung erhielt es die Lizenz für ein neues Magazin. In diesen Jahren lernte Ormond auch Henri Nannen kennen, den Mitlizenzträger der ersten deutschen Tageszeitung in Hannover, der Hannoverschen Neuesten Nachrichten, und späteren Chefredakteur des Stern. Erst am 5. März 1947 wurde Ormond britischer Staatsbürger. Er war jetzt Filmoffizier sowie Kontrolloffizier und Lizenzberater, zunächst für Niedersachsen, dann für die ganze britische Zone. Parallel dazu wechselte sein Einsatzort von Hannover nach Hamburg. In dieser Funktion führte er auch die Aufsicht über die Archive der früheren Reichskulturkammer. Anfang 1948 verließ Ormond die Britische Armee und ging als Hauptreferent für Lizenzfragen des britischen Informationsdienstes zur Control Commission for Germany, zur britischen Militärregierung, später High Commission for Germany, die direkt dem Foreign Office unterstand. Schon im September 1945 beobachtete Ormond an einigen Verhandlungstagen den von der britischen Militärregierung in Lüneburg durchgeführten Bergen-Belsen-Prozess, in dem alle Einzelheiten eines Vernichtungslagers aufgedeckt wurden. Einige Jahre später, im März 1949, wohnte er als Prozessbeobachter dem Verfahren gegen den Filmregisseur Veit Harlan in Hamburg bei, der besonders durch seinen Propagandafilm JUD SÜß (1940) bekannt geworden war. Der Vertreter der Anklage in diesem Prozess war Oberstaatsanwalt Gerhard Kramer; zu den Zeugen, die über die Wirkung des Films aussagten, zählte der Auschwitz-Überlebende Norbert Wollheim. Mit Kramer verband Ormond von dieser Zeit an eine enge Freundschaft, Wollheim vertrat er anwaltlich in einem der wichtigsten Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bis 1950 war Henry Ormonds Arbeit in Deutschland durch die britische Militärverwaltung bzw. das Außenministerium organisiert. Als er am 31. März 1950 aus britischen Diensten entlassen wurde, weil seine Aufgaben der Lizenzvergabe und Kontrolle nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland auf deutsche Behörden übergegangen waren und die entsprechenden alliierten Einrichtungen aufgelöst wurden, entschied er aus freien Stücken, wieder in Deutschland zu leben. Gemeinsam mit seiner Frau Jean, die seit 1946 ständig bei ihm lebte, zog der inzwischen 49-Jährige nach Frankfurt am Main, um dort wieder in einem juristischen Beruf zu arbeiten. Das Justizministerium von Württemberg-Baden fragte 1949 formlos an, ob er als Richter in den Staatsdienst zurückkehren wolle. Dies stünde ihm zu, da er noch nicht im Pensionsalter sei. Kehre er nach einem Antrag auf Wiedergutmachung nicht binnen drei Monaten in den Staatsdienst zurück, verlöre er seinen Anspruch darauf. Ormond lehnte eine Rückkehr in das Beamtenverhältnis jedoch ab. Er und seine Frau hätten dafür die englische Staatsangehörigkeit ablegen und die deutsche annehmen müssen, was er nicht wollte. Es sei ihm zudem nicht zuzumuten, unter Umständen mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die während des Nationalsozialismus an Verbrechen beteiligt gewesen seien, schrieb er an das Ministerium. Mit dem Justizministerium schloss Ormond am 15. Januar 1952 einen Vergleich, dem zufolge er mit Wirkung vom 1. Juni 1945 im Ruhestand belassen wurde und ab diesem Datum bis zum 31. März 1950 ein Ruhegehalt, berechnet nach den Versorgungsbezügen eines Beamten seiner Besoldungsgruppe, bezog. Darüber hinaus konnte er Wiedergutmachungsansprüche für die Zeit vom 1. September 1933 bis 31. Mai 1945 geltend machen, da er als Angehöriger der British Army deutlich weniger verdient hatte, als er es in seinem Richterberuf getan hätte. Wenige Monate nach ihrer Übersiedelung nach Frankfurt starb Ormonds Frau Jean, die schon seit Jahren an einer Lungentuberkulose litt, in einem Sanatorium in Bad Schwalbach. In Frankfurt hatte Ormond zunächst ein Büro in der Schillerstraße 30, zwischen 1954 und 1961 in der Schillerstraße 15-17 und 1961 bis 1973 in der Rahmhofstraße 4; nach seinem Tod zog es 1974 um in die Rahmhofstraße 2. Im Jahr 1963 schreibt er in einem Brief, dass seine Kanzlei zur einen Hälfte Entschädigungs-, Rückerstattungs- und Lastenausgleichssachen vertrete, zur anderen Hälfte allgemeine juristische Sachen wie Ehescheidungen, presse-, film- und wettbewerbsrechtliche Angelegenheiten und daneben wenige Straffälle. 1956 beschäftigte er zehn, 1964 sechs Juristen. Die ersten Mandate konnte sich Ormond über seinen früheren Arbeitgeber Nirmaier und seine Kontakte zu Zeitungs- und Medienunternehmen, unter anderem zum Spiegel und zum Stern, sichern. Seit 1950 war er Anwalt Norbert Wollheims, den er in dessen 1952 eröffnetem Entschädigungsprozess gegen die I.G. Farben AG i.L. vertrat. Die Verhandlung zog sich bis 1957 hin und forderte als Musterprozess Ormonds volle Konzentration. Zeitgleich jedoch agierte Ormond seit Sommer 1952 in dem ebenfalls sehr medienwirksamen sogenannten Eichberg-Prozess als Verteidiger von Karl Beckmeier. Beckmeier war verantwortlicher Redakteur der Illustrierten Stern und von den leitenden Ärzten der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg im Taunus (Hessen) wegen falscher Anschuldigungen angezeigt worden. Vorangegangen war ein mehrteiliger Bericht im Stern über die unmenschlichen Behandlungsmethoden psychisch Kranker in der Heilanstalt. 168 Zeugen wurden im Verlauf des Prozesses gehört, die zum Teil die Schilderungen des Journalisten Michael Heinze-Mansfeld, der die Artikelserie verfasst hatte, und des mitangeklagten Fotografen Rudolf Sievers bestätigten. Sie wurden in den Befragungen durch Staatsanwälte und als Sachverständige geladene Ärzte als "Psychopathen, als Schizophrene, als Süchtige hingestellt", "in eine Angeklagtenrolle gedrängt, einem hochnotpeinlichen Verhör unterzogen" und "Inquisitionsmethoden im wahrsten Sinne des Wortes ausgesetzt", so beschrieb Ormond die Situation im Gerichtssaal. Noch vor der Urteilsverkündung in diesem Prozess dankte der Stern-Herausgeber Henri Nannen Ormond für sein "in rechtlicher wie menschlicher Hinsicht überragende[s] Plädoyer", in dem sich Ormond viel mehr eingesetzt habe, "als füglich erwartet und erbeten werden konnte". Im Eichberg-Prozess war Ormond mit einer Institution konfrontiert, deren Strategie unter anderem darin bestand, ihre Sach- und Fachkenntnis gegen die eingeschüchterten Zeugen der Gegenseite auszuspielen. Die im Gerichtssaal erfolgte neuerliche Demütigung der Insassen der Heilanstalt Eichberg war für Ormond unerträglich. Ähnliche Erfahrungen mussten ehemals Verfolgte in Wiedergutmachungsprozessen machen, von denen Ormond viele nach dem erfolgreichen Wollheim-Prozess führte. Hier waren es vor allem die Beamten in den Wiedergutmachungsämtern, die versuchten, die berechtigten Ansprüche abzuwehren, und ehemals Verfolgte zwangen, für ihre verlorene Habe und die zerstörten Karrieren Beweismittel vorzulegen, die nicht zu beschaffen waren. Auch in späteren Prozessen bekam Ormond in der Haltung der Gegenseite und ihrer Anwälte oftmals das Fortwirken nationalsozialistischer Gesinnung zu spüren. Er scheute die Auseinandersetzung mit den Anwälten der Verteidigung in den NS-Strafprozessen nicht. Aufgrund eines Zusammenstoßes mit Rechtsanwalt Erich Schmidt-Leichner im Krumey-Hunsche-Prozess 1964/1965 musste er sich nach dessen Beschwerde über ihn gegenüber der Rechtsanwaltskammer rechtfertigen. In einem Brief an den befreundeten Oberstaatsanwalt Gerhard Kramer schrieb er:
"[Ich muß] es aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen, Belehrungen über das, was ›im Interesse des Ansehens der Anwaltschaft und der Justiz‹ (so er [d.i. Schmidt-Leichner] in einem Strafantrag) zu geschehen hat, von einem Mann hinzunehmen, der als verantwortlicher Sachbearbeiter der berüchtigten und schandbaren ›Nationalsozialistischen Richterbriefe‹ in entscheidender Stunde dazu beigetragen hat, das Ansehen und die Würde der deutschen Justiz in den Schmutz zu ziehen."
1966, im Anschluss an das erste skandalöse Urteil im Krumey-Hunsche-Prozess, stellte er nähere Untersuchungen über Schmidt-Leichner an und bemühte sich, Belege dafür zu finden, dass dieser als junger Jurist ins Reichsjustizministerium berufen worden war und dort Karriere gemacht hatte. Ormond wollte ganz offensichtlich den Ruf eines der "Staranwälte in Strafsachen" ankratzen, eines Mannes, der dazu beitrug, "daß Gericht, Staatsanwälte und Kollegen Angst vor seiner scharfen Zunge haben", und der öffentlich selbstherrlich und unangefochten auftrat. 1958 führte Ormond ein Prozess gegen den Lehrer Ludwig Pankraz Zind nach Offenburg. Zind hatte in einer Offenburger Gastwirtschaft gegenüber einem Zeugen erklärt, er bedaure, dass nicht noch mehr Juden von den Nazis vergast worden seien. Vor Gericht sagte ein anderer Zeuge aus, Zind habe an jenem Abend seinen Stolz darüber bekundet, "mit seinen Jungens Hunderten von Juden mit dem Spaten das Genick oder den Schädel eingeschlagen zu haben", was zu weiteren Ermittlungen gegen ihn führte. Der Prozess erregte großes Aufsehen, weil sich der Angeklagte im Gerichtssaal in keiner Weise reuig zeigte. Dieses Verhalten führte dazu, dass zahlreiche Sympathiebezeugungen für Zind bei der Staatsanwaltschaft eingingen. Etliche jüdische Nebenkläger sagten im Prozess aus. Ormond vertrat den Nebenkläger Heinz Galinski, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und Mitglied des in Düsseldorf ansässigen Direktoriums des Zentralrats der Juden in Deutschland, in diesem Verfahren. Ein Tübinger Kollege, Dr. Rudolf Zimmerle, war Anwalt weiterer Nebenkläger. Zind wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr wegen Beleidigung in Tateinheit mit fortgesetzter Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener verurteilt. Gegen dieses Urteil legte er Revision ein und setzte sich am Tag der Revisionsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe nach Ägypten ab. Ormonds Zusammenarbeit mit dem zuständigen Offenburger Oberstaatsanwalt Karl Nägele war sehr vertrauensvoll. Nägele bedankte sich bei Ormond im Anschluss an das Verfahren, indem er schrieb:
"Es war wirklich eine Freude und ein Ansporn, in dieser mitunter recht düsteren und peinlichen Atmosphäre Ihrer geschickten erfahrenen und vor allem menschlich so ansprechenden Hilfe sicher zu sein. Ich bin mir darüber im klaren, daß es mir allein nicht gelungen wäre, so viel Licht in dieses Dunkel zu bringen und das [sic!] Ergebnis der Beweisaufnahme ein so klares und eindeutiges Bild von Tat und Täter herauszukristallisieren."
Seit Ende der fünfziger Jahre war Ormond auch mit der Vorbereitung seiner Nebenklagevertretung im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess und im Krumey-Hunsche-Prozess beschäftigt. Wann er erstmals Kontakt zum hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer fand, ist seinem Nachlass nicht zu entnehmen. In seinen Kalendern, die sein Biograph Walter Witte ausgewertet hat, kommen Einträge mit der Erwähnung Bauers seit dem Jahr 1957 vor. Beide haben Sachfragen zu den anstehenden Prozessen vertrauensvoll erörtert und konzeptionelle Überlegungen angestellt. Bauer hat offenbar in Henry Ormond einen verlässlichen, mit internationalem Renommee ausgestatteten Mitstreiter gesehen, der nicht nur beste Beziehungen zu Überlebenden-Organisationen unterhielt, sondern auch von polnischen und israelischen Stellen sehr geschätzt wurde. Der Vertrauensperson Ormond gegenüber konnte Bauer auch sein Herz ausschütten. War Ormond eher ein reservierter, geradezu bedächtig auftretender Jurist, der gleichwohl, wenn es darauf ankam, kein Blatt vor den Mund nahm und unerschütterlich seinen Prinzipien folgte, so agierte Bauer voller Leidenschaft und zügelte seine Emotionen nicht. Ein Aktenvermerk Ormonds vom 21. Oktober 1963 bringt die Verschiedenheit der beiden Männer gut zum Ausdruck:
"Dr. Bauer kommt gerade vom Richtertag und ist über die Eindrücke, die er dort empfangen hat, ziemlich niedergeschlagen. Er fährt jetzt in Urlaub nach Rhodos und wird dann wiederum an einer Tagung teilnehmen. […] Über die langsamen Fortschritte, die das in Aussicht genommene Bürgerhaus [Gallus] als Verhandlungssaal für den Auschwitz-Prozess macht, ist er deprimiert."
Bauer fürchtete um die öffentlichkeitswirksame Durchführung des Verfahrens. Wenn das Bürgerhaus Gallus mit seinem großen Saal nicht zur Verfügung stehe und man "in dem viel zu kleinen Schwurgerichtssaal" tagen müsse, könne der Prozess "an Interesse für die Öffentlichkeit" verlieren und würden die zahlreich erwarteten Berichterstatter womöglich "enttäuscht der Sache den Rücken wenden und nicht mehr berichten". Der Aufklärer Bauer kommentierte die vermutete Sabotierung der Öffentlichkeitswirksamkeit des Prozesses mit den Worten: "Das sei ja aber wohl im Interesse mancher maßgebender Leute des öffentlichen Lebens." Auch privat verkehrte Ormond mit Bauer, und der hessische Generalstaatsanwalt machte ihn und Hermann Langbein mit Freunden wie Thomas Harlan bekannt. Außerdem waren gemeinsame Auftritte bei Veranstaltungen in Frankfurt am Main nicht selten. Ormonds Arbeitsbelastung in den Jahren 1964/1965 muss enorm gewesen sein. Vermutlich waren es der Auschwitz- und der Krumey-Hunsche-Prozess gegen die "wirklich Schuldigen", wie Ormond sie in seinem Kriegstagebuch nannte, aus denen er die Legitimation für seine Rückkehr nach Deutschland bezog. Wie viele Juden, die nach 1945 nach Deutschland remigriert waren, musste er sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, in das Land der Täter zurückgegangen zu sein. Es gab eine weltweit verbreitete Abscheu der Juden gegenüber Deutschland, dem Land der Mörder, die sich auch auf die in Deutschland lebenden Juden erstreckte. Sie entsprach quasi einem religionsgesetzlichen Bann, auch wenn ein solcher von niemandem verfügt worden war. Die Aufmerksamkeit vieler in Deutschland lebender Juden richtete sich daher auf Israel, mit dem sie sich solidarisch erklärten. So auch die Henry Ormonds.