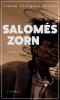Die Früchte von Salomés Zorn
Bewertet mit 3 Sternen
Salomé ist die Tochter einer niederländischen Mutter und eines kamerunischen Vaters. Sie ist den Niederlanden geboren und aufgewachsen, wird aber seit dem Bau eines Flüchtlingsheims im Dorf plötzlich automatisch als „ausländisch“ wahrgenommen. Mit dem Wechsel auf das Gymnasium beginnt ihr Martyrium unter dem Mobbing weißer Jungs, die sie auch körperlich angreifen. So schafft ihr der Vater einen Punchingball an und zeigt ihr, wie sie sich verteidigen kann. Sie solle hart arbeiten und sich nicht beklagen, sich aber auch nicht zum Opfer machen lassen, im Zweifel durch den Feind durchschlagen. Als viele Faktoren zusammenkommen übertreibt es Salomé mit der Verteidigung und begeht eine Körperverletzung. Ausgangspunkt des Buches ist nun ihr Einzug in ein Jugendgefängnis. Nach und nach erfahren wir die Umstände ihrer Handlung aber auch die Ursachen, die dazu geführt haben.
Simone Atangana Bekono lässt ihre Protagonistin als jugendliche Ich-Erzählerin auftreten. Wir lesen ihren Gedankenstrom rund um die Inhaftierung und erleben ihren holprigen Weg zum Wandel mit. Das ist sprachlich nicht schlecht gemacht, wähnt man sich doch noch während der ersten Hälfte des Romans in einem Jugendroman. Wobei Salomé sich sehr differenziert ausdrücken kann, ist sie doch eigentlich eine sehr intelligente Schülerin gewesen, bevor es bergab mit ihr ging. Manchmal dreht sie aber auch durch und das spiegelt sich dann in ihrem Gedankenstrom adäquat wieder.
Die Grundidee zu diesem Roman finde ich hochinteressant: Eine jugendliche, weibliche Gewalttäterin, mit dunkler Hautfarbe, aus der Arbeiterschicht kommend. Allem voran ist der Aufenthaltsort der Jugendstrafanstalt etwas Besonderes. Hinzu kommt ein Therapeut, der versucht Salomé bei der Aufarbeitung ihrer Tat zu helfen. Nur ist dieser Therapeut oder vielmehr seine Hintergrundgeschichte unglaublich abstrus. Dieser hat ein Jahr zuvor bei einer Reality-TC-Show mitgemacht, in welcher er mit seiner Partnerin in ein afrikanisches Dorf geschickt wurde. Obwohl er es gut meint mit allem, verhält er sich aber naiv-rassistisch und merkt es nicht mal. Dieses Thema wird in der ersten Hälfte des Buches äußerst stark ausgebreitet, ist einfach nur skurril. In der zweiten Hälfte spielt die ganze Sache aber plötzlich keine Rolle mehr, ja, eigentlich spielt der Therapeut an sich keine Rolle mehr, ohne eine Herleitung, warum das jetzt im Plot so angelegt wurde. Dieses Stilmittel auf der Handlungsebene wirkt somit nicht zielorientiert und obsolet. Ebenso eingeworfen wirkt ein Stilmittel, welches häufiger in der zweiten Hälfte des Romans auftritt. Salomé hat auf dem Gymnasium den Griechischunterricht besucht und bindet daher stets griechische Sagen- und Tragödienfiguren in ihre Gedanken ein. Diese wirken aber mitunter nicht wirklich passend und scheinen nur da zu sein, um etwas cooles Intellektuelles in den Text einzuweben.
Nachdem mich der Roman zu Beginn nicht packen konnte, habe ich ab der Mitte sehr interessiert die Geschichte um Salomé verfolgt. Gerade die Abläufe im Jugendgefängnis sowie der Umgang der jugendlichen Straftäterinnen mit Impulskontrollstörungen untereinander waren sehr realitätsnah erzählt. Nur das Ende wirkte dann wieder vollkommen wirr und auch nicht wirklich nachvollziehbar. Irgendwie ein insgesamt „unrundes“ Lektüreerlebnis, dem eine interessanten Konstellation zugrunde liegt, aber in der Gesamtheit mich nicht wirklich überzeugen konnte. Wäre der schräge Therapeut nicht im Buch aufgetaucht und hätte den Fokus von Salomés abgelenkt, hätte mir die Geschichte vielleicht insgesamt besser gefallen. Die Geschichte hat Potential, welches allerdings nicht vollständig ausgeschöpft wurde.
3/5 Sterne