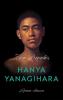Ein volles Haus
Bewertet mit 4 Sternen
In die Neugier und freudige Erwartung auf Hanya Yanagiharas neues Buch mischten sich auch leise Sorgen, ob ich nach „Ein wenig Leben“ wohl einer weiteren so intensiven, emotionalen wie schmerzhaften Geschichte gewachsen wäre. Als hätte sie meine Furcht gespürt, führt mich Yanagihara behutsam in ihr Setting ein und aufatmend lasse ich mich hinein fallen in eine scheinbar klassische Geschichte über die Liebe, die die typischen Komponenten des Topos reich verliebt sich in arm um einige alternative Arrangements erweitert. Yanagiharas New York des Jahres 1893 hat wenig mit dem historischen N.Y. unserer Welt gemein. Die Vereinigten Staaten Amerikas haben sich nicht zu einem Land zusammengerauft, sondern sind in verschiedene kleinere Territorien unterteilt. New York gehört zu den liberalen Freistaaten, in denen gleichgeschlechtliche Liebe nicht nur erlaubt, sondern richtig gelebt wird. In den südlichen Kolonien hingegen würde man sein Leben verlieren, sollte man nur in den Verdacht geraten, sich vom eigenen Geschlecht angezogen zu fühlen. Letztlich nimmt die Autorin die Gegensätze der heutigen amerikanischen Bundesstaaten auf und spitzt sie in ihrem Plot etwas radikaler zu. Im Kern trifft sie mit ihrer Darstellung genau mein Gefühl von den verschiedenen Welten, in denen sich US-Bürger je nach geografischer Lage bewegen. Und als der junge, reiche Bankierssohn David Bingham vor der Entscheidung steht seine Familie zu verlassen und mit dem bettelarmen Edward Bishop an der Westküste ein neues, etwas ungewisses Leben zu beginnen, endet das erste Buch und Yanagihara springt 100 Jahre weiter. Gleiches schönes Haus am Washington Square, wieder steht ein David Bingham im Mittelpunkt, diesmal als Lebenspartner des reifen Charles und mitten hinein in die Zeit als das Hi-Virus wütet. Aids, die Seuche der Schwulen, die in den 1990er Jahren das epidemische Zeitalter einläutet. Es geht ums Sterben, ums Leben, ums Lieben und um ein verlorenes Königreich auf Hawaii. David entstammt der abgesetzten Königsfamilie auf Hawaii und wie im ersten Buch hat sich die Figur David gegen seine Familie entschieden und für ein selbstbestimmten Leben in New York. Was wird uns wieder 100 Jahre weiter am Washington Square erwarten? Denn ganze drei Bücher hat Yanagihara in dieses eine gepackt. Der rote Faden ist das herrschaftliche Haus am Washington Square in New York. Es ist Schauplatz und Kulisse für drei Settings in zeitlichen Abständen von jeweils 100 Jahren. Das ist aber auch die einzige Gewissheit, die uns die Autorin lässt. Sie spielt mit den tradierten Erzählmustern. Verwendet immer wieder die gleichen Namen in allen drei Büchern und setzt die so gleich benannten Figuren in neuen Konstellationen zusammen. Schwerpunkt bildet die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen den männlichen Figuren. Großväter und Großmütter übernehmen die Rolle der Eltern, die aus unterschiedlichen Gründen zu früh gegangen sind. Wie eine Ertrinkende suche ich in den Erzählwellen nach mir bekannten Mustern. Mein Kopf will unablässig die Familienstammbäume sortieren und die Davids, Charles, Nathaniels, Peters, Alices und Edwards der 300 Jahre miteinander verbinden. Es muss doch einen Zusammenhang geben. Ich bin am Ende aller Geschichten dann nicht einmal mehr sicher, ob alle drei Bücher in derselben alternativen Welt spielen. Es könnte sein, dass ich das nur annehme, weil das ein gewohntes Erzählmuster ist.
In Teilen mit dem tradierten Narrativ zu spielen und gar zu brechen, ermöglicht es der Autorin sich stärker mit den Kernthemen ihres Romans zu befassen. Ich lese heraus, dass es ihr vor allem um Identität, Beziehung und Familie geht. Doch nicht losgelöst von den äußeren Umständen. Die Mächte von außen durch Staat und Gesellschaft wirken auf den Einzelnen ebenso wie die Einflüsse der familiären und amourösen Beziehungen. Doch Yanagihara führt auf simple wie beeindruckende Weise vor, dass gleichgeschlechtliche Liebe zu keiner Zeit Teil des Identitätskonfliktes ist, wenn sie gesellschaftlich als Norm fungiert. Für David aus dem ersten Buch geht es in seiner Liebe zu Edward um die Grundfeste zwischen zwei Menschen: Vertrauen. Es könnte sein, dass ihn der mittellose Edward nur wegen seines Geldes benutzt. Doch darauf will David es ankommen lassen. Er stellt sein Glück über die Familie, die vorgibt ihn schützen zu wollen, ihm gleichzeitig aber kein eigenes Urteil zutraut. Ein klassisches Tragödiensetting. Funktioniert bestens mit zwei Prinzen und keiner Prinzessin. Und auch Charles Entfremdung von seinem Mann und Sohn hat nichts mit der gelebten Homosexualität zu tun, sondern mit seiner persönlichen Entwicklung als Mensch, der die Karriere über die Familie stellt und sich dann angegriffen fühlt, als er merkt, dass die Bindung zu seinen Liebsten nachlässt. Schwierig wird es für seine Enkelin Charlie, die von Staatswegen heiraten muss und wider besseres Wissen lange Zeit hofft, dass sich ihr homosexueller Angetrauter doch in sie verliebt. In Charlies Welt zwingt der Staat seinen Bewohnern eine Norm auf, die in erster Linie der Fortpflanzung dienen soll. Gleichgeschlechtliche Beziehungen geraten nach langen Jahren, Jahrhunderten als Teil der Norm plötzlich ins Abseits, in den Untergrund. Heiraten ist nur noch zwischen Mann und Frau möglich.
Auf Yanagiharas Romane muss man sich ganz einlassen, sonst ist man ihnen nicht gewachsen. Auch „Zum Paradies“ bringt mich zuweilen an meine Grenzen. Inmitten meiner eigenen pandemischen Wirklichkeit führt sie mir im dritten Buch eine dystopische Zukunft vor, in der die Abstände zwischen auftretenden Pandemien immer kürzer werden und eine Entwicklung im einst demokratischen Staat vorangetrieben hat, in der man das Leben fast nicht mehr als Leben bezeichnen mag. „Zum Paradies“ ist so, wie es auf dem Buchrücken anpreisend geschrieben steht: „Indem sie die Schicksale von drei Menschen aus drei Jahrhunderten in einem einzigen Haus zusammenführt, kann sie von beinahe allem erzählen, worüber sich heute zu erzählen lohnt.“ Nicht mehr, nicht weniger.